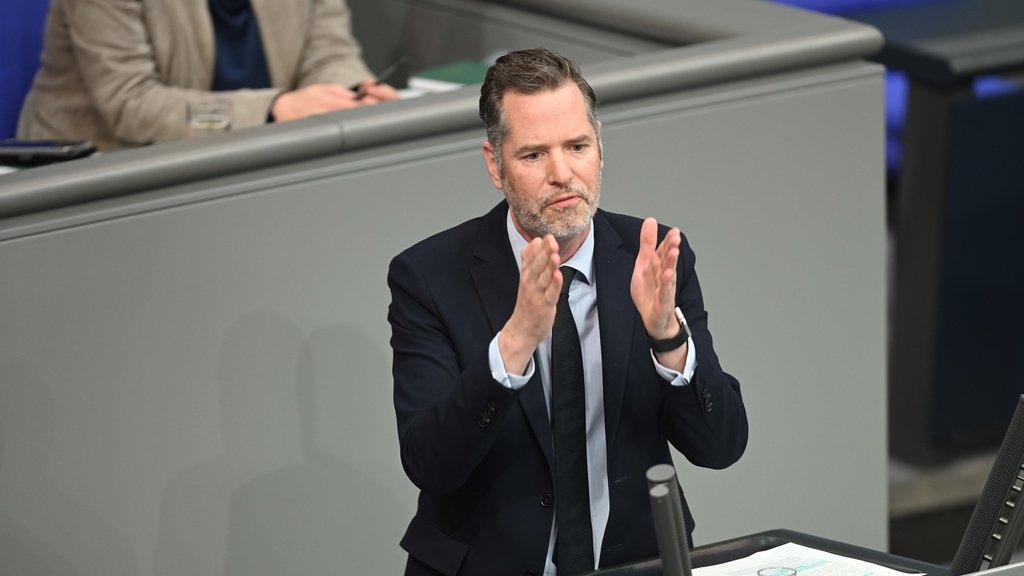Verfassungsfeindlichen Parteien, die wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nicht verboten werden können, soll die staatliche Parteienfinanzierung entzogen werden. Das Vorhaben ist verständlich, aber nicht zu begrüßen, meint Sebastian Roßner.
Politische Vorschläge mit Realisierungschance, die spontan das Glückszentrum im Hirn stimulieren, vernimmt man nicht oft. Jetzt sorgen überraschenderweise der sonst wenig glamouröse Bundesrat und der grimmige Terroristenbekämpfer Bundesinnenminister de Maizière für einen dieser seltenen Momente. Misstrauen gegenüber dem Glücksgefühl ist aber gerechtfertigt.
Die Inspiration für Bundesrat- und innenminister kam aus Karlsruhe. Am 17. Januar hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) judiziert, die NPD könne man zwar wegen ihrer politischen Bedeutungslosigkeit nicht verbieten. Es sei aber möglich, verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, indem man das Grundgesetz und die übrigen einschlägigen Gesetze ändere.
Die Politik nahm den Ball rasch auf. Am 10. März verabschiedete der Bundesrat zwei Gesetzentwürfe (Bundesratsdrucksachen 153/17 (B) und 154/117 (B)), um Art. 21 Grundgesetz (GG) sowie das Parteiengesetz, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das Einkommenssteuergesetz und das Körperschaftssteuergesetz zu ändern.
Kein Entzug des Geldes ohne Potential der Partei
Die Entwürfe zielen darauf, beim BVerfG ein neues Verfahren zum Entzug der staatlichen Finanzierung für Parteien einzurichten, die nach der alten, mit dem zweiten NPD-Urteil vom 17. Januar 2017 überholten Rechtsprechung die Kriterien für ein Parteiverbot erfüllt hätten.
Für einen Finanzierungsentzug soll es danach zukünftig ausreichen, wenn eine Partei aktiv-kämpferisch darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Um verboten zu werden, müsste die entsprechende Partei hingegen nach der neuen Verbotsrechtsprechung zusätzlich "Potentialität" aufweisen, was bedeutet, dass die Verwirklichung der gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Parteiziele nicht völlig ausgeschlossen scheint.
Folgen des Finanzierungsentzugs sollen vor allem ein Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung nach dem Parteiengesetz und ein Ende der einkommenssteuerlichen Privilegierung von Spenden an die Partei sein.
Einen ähnlichen Vorstoß unternahm Anfang April auch Bundesinnenminister de Maizière mit einer "Formulierungshilfe" für die Spitzen der Koalitionsfraktionen im Bundestag, die faktisch einem Gesetzentwurf entspricht.
Widerspruch ist bei Finanzierungsentzug schärfer
Es ist verständlich, dass die Politik schnell das aus Karlsruhe vorgegebene Thema des Finanzierungsentzugs aufgriff, denn es ist widersprüchlich, Parteien mit Steuergeldern zu unterstützen, die sich aktiv gegen die Freiheit und die Demokratie wenden. Dennoch ist es besser, diesen Widerspruch auszuhalten, als mit dem Finanzierungsentzug einen neuen und schärferen Widerspruch zu schaffen.
Zunächst kann es taktisch-politisch unklug sein, wenn der Staat einzelnen Teilnehmern ein Handicap auferlegt. Einerseits fügt der Staat einer betroffenen Partei zwar finanziellen Schaden zu, andererseits aber schafft dies für die Partei Publicity und die gewissermaßen amtliche Bestätigung der eigenen Opferrolle, was gerade die Anhängerschaft von radikalen Parteien mobilisieren kann.
2/2: Abwägung: Finanzieller Nachteil oder propagandistischer Vorteil
Ob der finanzielle Nachteil oder der propagandistische Vorteil für eine Partei schwerer zu gewichten ist, lässt sich nicht allgemein bestimmen. Bei der Entscheidung, ob man Parteien die staatliche Finanzierung entzieht, wird es aber stets um bösartige Zwerge gehen, die man gerade wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nicht verbieten kann.
Die staatliche Finanzierung ist in solchen Fällen nicht sehr hoch, denn die Höhe der Geldüberweisung durch den Staat an die Parteien ist abhängig vom Erfolg bei Wahlen in der Vergangenheit und von der Höhe eigener Spendeneinnahmen. Die NPD allerdings würde hart getroffen, falls man ihr die staatlichen Mittel entzöge, da sie einerseits seit längerem in finanziellen Nöten schwebt und andererseits, vor allem wegen der relativ vielen gewonnenen Stimmen bei den Landtagswahlen in Sachsen, gegenwärtig immerhin über eine Million Euro vom Staat zu erwarten hat, wobei diese Summe in Zukunft wegen fehlender neuer Erfolge aber schrumpfen wird.
Regeln nicht für den Einzelfall
Regeln des politischen Wettbewerbs werden jedoch nicht für einen Einzelfall gemacht und sollten nicht lediglich anhand von Einzelfällen beurteilt werden. Auf lange Sicht schädigen die Pläne für den Finanzierungsentzug die Demokratie subtil, aber nachhaltig. Denn Demokratie beruht auf Gleichheit, wie Aristoteles in seiner "Politik" feststellt. Im Ursprung beruht sie auf der Gleichheit der wählenden Bürger, davon abgeleitet auf der Gleichheit der Kandidaten und auf der Gleichheit der Gewählten, kurz, auf der Gleichheit des politischen Wettbewerbs. Deshalb schützt das Grundgesetz mit Art. 38 Abs. 1, Art. 21 und Art 3 Abs. 1 verschiedene Bestandteil dieses Wettbewerbs in besonderer Weise.
Ob die Gleichheit beachtet wird, ist folglich der Prüfstein für die demokratische Qualität politischer Verfahren. Entzieht der Staat bestimmten Parteien aus inhaltlichen Gründen die staatliche Finanzierung, greift er in die Gleichheit der politischen Parteien ein. Das ist zwar technisch möglich, indem man - wie geplant - das Grundgesetz entsprechend ändert. Doch Demokratie zieht ihre Stärke daraus, dass politische Auseinandersetzungen in einem friedlichen Wettbewerb von Interessen und Personen entschieden werden können. Dies setzt voraus, dass die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen unanfechtbar sind, weil sie in einem untadeligen Verfahren zustande gekommen sind, das insbesondere allen Wettbewerbern gleiche Bedingungen bietet.
Die Weisheit des Grundgesetzes
Das Grundgesetz hat daher mit Art. 21 Abs. 2 eine weise Regelung getroffen. Nur wenn eine Partei den demokratischen Wettbewerb selbst gefährdet, darf sie ausnahmsweise ausgeschlossen werden. Alle anderen Parteien können unter gleichen Bedingungen am politischen Wettbewerb teilnehmen. Dieses Entweder - Oder schützt die Überzeugungskraft des demokratischen Prozesses.
Die Pläne zum Finanzierungsentzug widersprechen dagegen den Prinzipien des demokratischen Wettbewerbs, so wie eine Regelung dem Gedanken des sportlichen Wettbewerbs widerspräche, die für minder schwere Dopingfälle anordnet, dass der Delinquent mit zehn Metern Rückstand zum olympischen Hundertmeterlauf antreten muss. Die Goldmedaille würde entwertet. Für den politischen Wettbewerb ist es besser, zähneknirschend die bösartigen Kleinparteien weiterhin finanziell zu unterstützen, als sich in Widerspruch zur demokratischen Gleichheit zu setzen.
Der Autor Dr. Sebastian Roßner ist Habilitand am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Sebastian Roßner, Staatliche Parteienfinanzierung: Kein Geld mehr für bösartige Zwerge . In: Legal Tribune Online, 11.04.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22634/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag