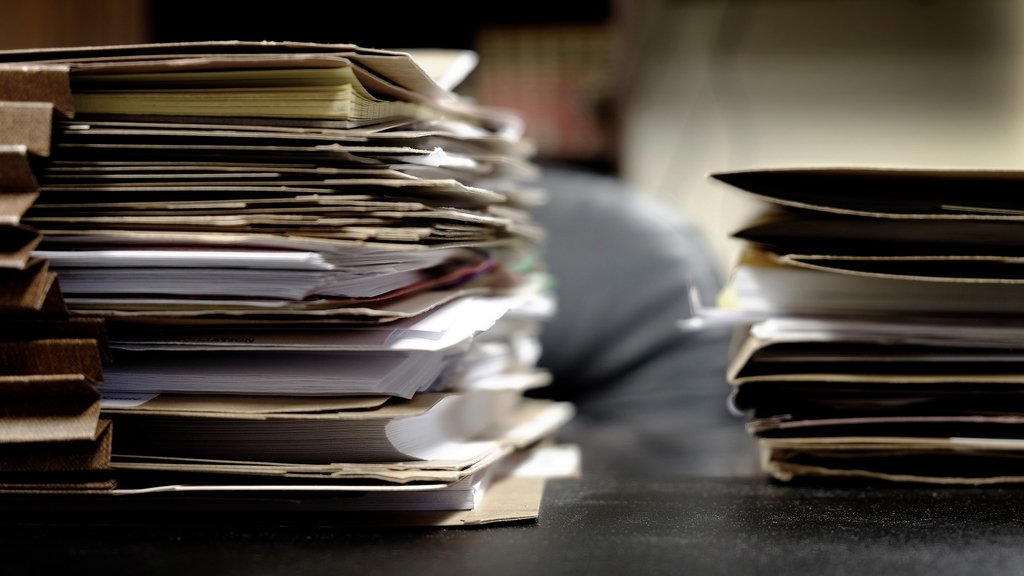Im Januar 1948 standen Richter vor der Frage, ob und wie sie den Begriff "gesundes Volksempfinden" auslegen sollten. Um diesen etwas toxischen Rechtsbegriff wurde erneut 40 Jahre später gestritten – und dabei um Political Correctness.
Das Oberlandesgericht für Hessen (Senat Kassel) hatte im Januar 1948 über die Sache eines Angeklagten zu befinden, dem unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen wurde. Der "Meister im Kraftfahrzeughandwerk, Inhaber einer Tankstelle, Fahrlehrer und Eigentümer von zwei Personenkraftwagen" hatte sich trotz Aufforderung eines Krankenhausarztes geweigert, eines seiner Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, um einen in Lebensgefahr schwebenden Verunglückten in die nächstgrößere Klinik zu transportieren.
Ein vom Krieg verheertes Land, ein dramatischer Mangel an Fahrzeugen, in privater Hand ebenso wie bei den Rettungsdiensten auf dem flachen Land, Hungerwinter nun auch für Deutsche – mit grobem Pinsel lässt sich der historische Hintergrund der Jahre 1947/48 vielleicht auf diese Weise kolorieren.
Ein scharfes Urteil, so sollte man denken, ist hier schnell zur Hand. In Notzeiten lässt sich über die Sozialpflichtigkeit von Eigentum leichter reden, zumal wenn es sich um relativen Luxus handelt. Und nach dem Tod von Millionen Menschen sollte es jedermann eine offensichtliche Ehre sein, Meister Schnitter in den Arm zu greifen.
Alliierte verbieten es, Richter legen es aus
Sowohl das Amtsgericht wie das Oberlandesgericht sprachen den angeklagten Kraftfahrzeug-Eigentümer jedoch vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung frei, da die Strafnorm nicht angewendet werden könne (OLG Hessen, Urt. v. 22.1.1948, Az. Ss 107/47).
Die Norm, § 330c Strafgesetzbuch (StGB), in Kraft seit dem 1. September 1935, hatte folgenden Wortlaut:
"Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies nach gesundem Volksempfinden seine Pflicht ist, insbesondere wer der polizeilichen Aufforderung zur Hilfeleistung nicht nachkommt, obwohl er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten genügen kann, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."
Bis 1953 lag nun ein Problem des deutschen Strafrichters in der möglicherweise entgegenstehenden Vorschrift II Nr. 3 der Kontrollratsproklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945, mit der die Alliierten "Grundsätze für die Umgestaltung der Rechtspflege" im besetzten Deutschland aufstellten. Denn die Proklamation befahl:
"Kein Gericht darf irgendeine Handlung auf Grund von 'Analogie' oder im Hinblick auf das sogenannte 'gesunde Volksempfinden' für strafbar erklären, wie es bisher im deutschen Strafrecht der Fall war." Das Gesetz der Militärregierung Nr. 1 zur Aufhebung Nationalsozialistischer Gesetze vom 20. September 1945 gab in Artikel IV Ziffer 7 das Gleiche vor.
Mit dem alliierten Befehl war das Merkmal des "gesunden Volksempfindens" für den deutschen Richter allerdings noch nicht aus der Welt. Denn u.a. in den §§ 240 Abs. 2 und 253 Abs. 2 StGB, also im Nötigungs- und Erpressungstatbestand, war es 1943 als Kriterium eingeführt worden.
Nach diesen Vorschriften sollte die Strafbarkeit davon abhängen, dass es "dem gesunden Volksempfinden widerspricht", Gewalt anzuwenden oder ein Übel anzudrohen, um den "angestrebten Zweck" zu verfolgen.
"Uneinsichtkeit und Starrköpfigkeit der Eifler Bevölkerung"
Die hessischen Richter erklärten, dass die Formel vom "gesunden Volksempfinden" zwar in Fällen der §§ 240, 253 StGB einer Bestrafung nicht entgegenstehe, weil sie dort nicht als neuer Strafgrund, sondern nur als Auslegungsregel anzusehen sei.
Im Fall des § 330c StGB a.F. sei jedoch nach "gesundem Volksempfinden" darüber zu entscheiden, ob eine Hilfeleistung Pflicht ist. Als strafbegründendes Tatbestandsmerkmal sei seine Anwendung hier daher durch die Regelungen der alliierten Militärregierung verboten. Vom Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung bliebe damit nur die Weigerung, auf polizeiliche Anweisung zu helfen, wie sie vor 1935 als Übertretung nach § 360 Abs. 1 Nr. 10 StGB mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft bedroht war.
Eine andere Auffassung vertrat – mehrheitsfähig – das OLG Koblenz mit Urteil vom 12. Februar 1948 (Az. Ss 5/48). Hier hatte sich ein Arzt geweigert, einem Landwirtssohn einen Hausbesuch abzustatten, der im Lauf des Tages von einem Pferd "gegen den Bauch geschlagen" worden war.
Der Arzt hätte, statt sich auf einen Bericht über die Verletzung aus zweiter Hand zu verlassen, die ihm bekannte "Uneinsichtigkeit und Starrköpfigkeit der Eifler Bevölkerung" – so das Landgericht in der Vorinstanz – berücksichtigen und den Bauerssohn zu einem sofortigen Klinikaufenthalt überreden müssen. Der verstarb über dem Pferdetritt. Anders als der Arzt stand zumindest der Kaplan am Krankenbett.
Das OLG Koblenz interpretierte den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung geltungserhaltend dahin um, "daß an Stelle des Begriffs 'gesundes Volksempfinden' der Begriff 'gute Sitten' zu treten habe und damit das natsoz. Schlagwort mit einer Möglichkeit einer willkürlichen Auslegung durch den richtigen Bewertungsmaßstab, der seinem sachlichen Inhalt entspreche, ersetzt werden müsse. Es komme auf das an, was dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden, also dem nach der herrschenden Volksauffassung Üblichen, Landläufigen oder Verkehrsmäßigen entspreche."
2/2: Das "gesunde Volksempfinden" seit 1935
1953 passte der Bundesgesetzgeber das Strafgesetzbuch an die solcherart vorgezeichnete Rechtsprechung an, indem er den Begriff durch andere Abwägungsformeln ersetzte, die den Strafrichtern allerdings bis heute eine moralisch wertende Aussage der Jedermannspflichten im Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung oder der Zweck-Mittel-Relation bei einer Nötigung jedenfalls offener halten als dies im dogmatisch engeren Gehäuse der Auslegungsarbeit gesetzlich klarer Begriffe üblich ist.
Solcherart aus dem Tagesgeschäft der Strafrechtspflege ausgeschieden, erfuhr das "gesunde Volksempfinden" seit den 1950er Jahren Konjunktur im polemischen Schlagabtausch. Anders als die kaum weniger angreifbare Phrase des "gesunden Menschenverstands" galt es als ausgemacht, dass das "gesunde Volksempfinden" eine spezifisch nationalsozialistische Pathosformel war.
Dass am Begriff des "gesunden Volksempfindens" Anstoß genommen wird, ist leicht nachzuvollziehen, fand es sich doch nicht nur in einzelnen Normen des besonderen Strafrechts. Vielmehr war mit ihm seit dem 1. September 1935 jeder Schutz der liberalen Rechtstradition beseitigt worden. § 2 Abs. 1 StGB in seiner erst von den Alliierten aufgehobenen Fassung gab vor: "Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient."
Ein Beitrag des Frankfurter Rechtshistorikers und Privatrechtsgelehrten Joachim Rückert (1945–), der es unternahm, das "gesunde Volksempfinden" in Rahmen einer Ideengeschichte zu kontextualisieren, in der eine kreatürliche Indienstnahme des Begriffes "Volk" gegen das abstrakte Recht bis in die Zeit Friedrich Carl von Savignys (1779–1861) zurückverfolgt wurde, blieb als hochgelehrter Aufsatz in der "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte" (GA 1986, S. 199–245) vor einer breiten Öffentlichkeit verborgen – und hätte wohl schon vor Erfindung von Social-Media-Netzwerken der Sache kaum den polemischen Zahn ziehen können.
Fahrlässiges Herumhitlern?
Anlass zu einem Streit um die politische Inkorrektheit des Begriffs gab 40 Jahre nach seiner Außerdienstnahme ein Urteil des LG Flensburg vom 1. September 1992 (Az. 2 O 265/92).
Die Eltern eines behinderten, pflegebedürftigen Sohns hatten ihr Testament so gestaltet, dass der Nachlass nicht durch die Heimkosten ihres Kindes aufgebraucht werden sollte. Die Nichtigkeit begründeten die Flensburger Richter u.a. wie folgt:
"Solcherlei Manipulationen widersprechen aber nach Auffassung der Kammer dem Rechtsempfinden eines jeden billig und gerecht Denkenden und sind mit jeglichem gesunden Volksempfinden schlechthin nicht vereinbar."
Die Richterin Heidemarie Renk warf ihren Flensburger Kollegen einen "dogmatisch überflüssigen, rechtspolitisch und methodologisch aber beachtlichen Rekurs dreier Berufsrichter auf völkische Befindlichkeiten" vor. Sie hätten sich dazu entblödet, auf eine der "standardisierten Formeln in der nationalsozialistischen Rechtsprechung" zurückzugreifen (NJW 1993, S. 2.727 f.).
Dies kritisierte wiederum der Verfassungsjurist Ingo von Münch (1932–) als überzogene Sprachkritik und versuchte sich an einer Differenzierung zwischen im NS-Staat propagandistisch missbrauchten Begriffen wie besagtem "Volksempfinden" und evident mörderischen, etwa dem des "Volksschädlings" (NJW 1994, S. 634 f.).
Dank von Münchs ergänzendem Tu-quoque-Hinweis u.a. darauf, dass in linksgrünen Kreisen widerwärtige Gleichsetzungen der modernen Massentierhaltung mit NS-Vernichtungslagern umliefen, und seiner Warnung vor der amerikanischen Manie der "Political Correctness" bot das orange Magazin aus München 1992–94 damit alles, was einen derartigen Schlagabtausch bis heute auszeichnet:
Fahrlässiges oder bewusstes semantisches Herumhitlern, dann scharfe, vom eigentlichen Gegenstand abstrahierende Sprachkritik, schließlich Relativierungsübungen samt zartem bis grobem Whataboutismus.
Über dem Reizwort vom "gesunden Volksempfinden" unterblieb das, was man sich in einer offenen Gesellschaft wünschen würde: eine breite politische Diskussion darüber, wie viel Privat-/Nachlassvermögen behinderten Menschen nach Abzug ihrer Sonderkosten verbleiben sollte.
Wenigstens fand sich über allem ein Grund, die "NJW" zu lesen: Man konnte mit ihr lernen, gegenüber Hashtag-Kontroversen stoisch zu werden, bevor überhaupt jemand wusste, dass es derlei einmal geben würde.
Der Autor Martin Rath arbeitet als freier Lektor und Journalist in Ohligs.
Martin Rath, Strafrecht nach dem Krieg: Was tun mit dem "gesunden Volksempfinden"? . In: Legal Tribune Online, 28.01.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/26721/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag