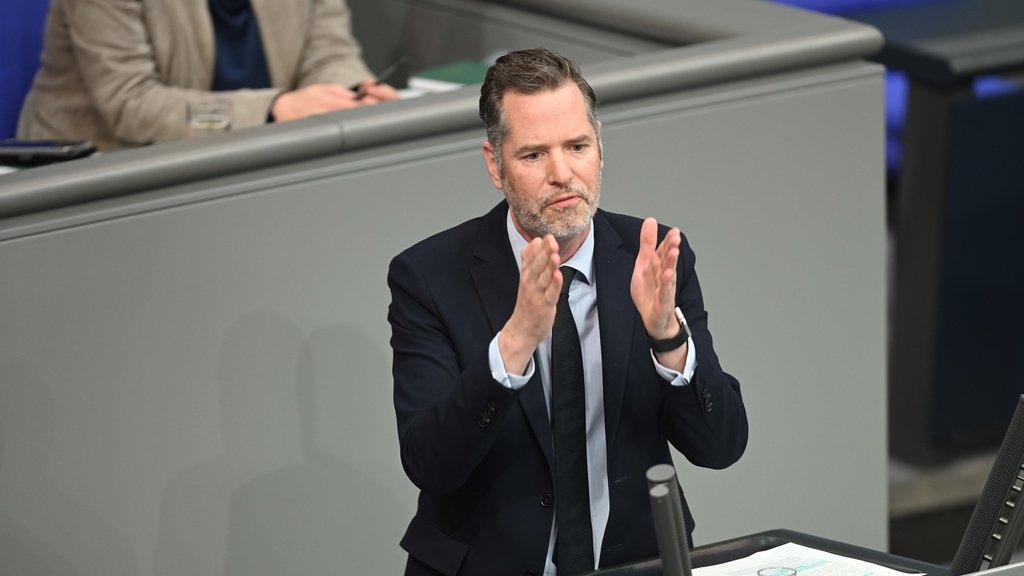Dass man von der Besetzungskrise am polnischen Verfassungsgericht zuletzt wenig gehört hat, heißt nicht, dass sie vorüber wäre. Im Gegenteil: Im Machtgefüge von polnischer Justiz und Exekutive tun sich weitere Brandherde auf.
Einstellung und Vorgehen wichtiger Entscheidungsträger der polnischen Regierungspartei PiS gegenüber der Richterschaft haben in den letzten Jahren zu besorgten Debatten in Fachkreisen und politischen Spannungen gegenüber der EU geführt. Wer das Geschehen in den polnischen Medien verfolgt, wird Zeuge einer zusehends rabiater geführten Auseinandersetzung, die weniger mit der Suche nach gemeinsamen Lösungen denn mit einem Kulturkampf zu tun hat.
Die jüngsten Maßnahmen der PiS fügen sich in die seit zwei Jahren betriebene, von Feindseligkeit geprägte Rhetorik gegenüber der "Richterkaste". Richter sind demnach – so die Pressesprecherin der PiS-Fraktion im April 2016 – eine "Gruppe von Kumpel[n], die den status quo der vergangenen Regierung verteidigen." Aufmerksamkeit verdienen im Vorgehen der Partei vor allem drei politische Coups mit verheerender Negativwirkung für die Glaubwürdigkeit der Gerichte, die in der polnischen Medienöffentlichkeit kontrovers diskutiert werden.
I. Austausch von Verfassungsrichtern
Gleich nach den Parlamentswahlen Ende 2015 machte sich PiS an die Verwirklichung des Wahlkampfmottos „gute Veränderung“, deren Inhalte nun peu à peu enthüllt werden. So galt es zunächst, im polnischen Verfassungsgericht (Verfassungstribunal) für parteigemäße Ordnung zu sorgen und Richter mit Verbindung zur letzten Regierung (der „Bürgerplattform“ – PO) von der Entscheidungsfindung auszuschließen. Die Methode war einfach: In der letzten Sitzung des polnischen Parlaments (Sejm) unter Regierung der PO wurden fünf Verfassungsrichter ernannt, deren Amtszeit am 7. November bzw. 3. oder 9. Dezember 2015, also schon nach Konstituierung des neuen Sejm am 12. November 2015, beginnen sollte. Dieses Vorgehen entsprach den Vorgaben des im Juni 2015 novellierten Gesetzes über das Verfassungstribunal, deren Verfassungsmäßigkeit anfangs von der PiS-Fraktion, in der neuen Legislaturperiode aber von der PO-Fraktion in Frage gestellt wurde.
Noch bevor sich das Verfassungstribunal mit dem Kontrollverfahren befassen konnte, beschloss der Sejm im Eiltempo – das gesamte Gesetzgebungsverfahren dauerte etwa eine Woche – ein neues Gesetz über das Verfassungsgericht, nach dem der Präsident und Vizepräsident des Verfassungstribunals deutlich vor dem Ende der regulären Amtszeit ihre Positionen verlieren sollten. Ferner wurde bestimmt, dass die Positionen der in der vergangenen Legislaturperiode ernannten Richter neu besetzt werden müssten. Gleichzeitig fasste der Sejm einen Beschluss "über die fehlende Rechtskraft" der Ernennungsbeschlüsse vom Ende der letzten Legislaturperiode. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember vereidigte Präsident Duda sodann vier neue Verfassungsrichter; der fünfte folgte am 9. Dezember 2015.
Ia. Nichtpublikation unliebsamer Entscheidungen
Ebenfalls am 3. Dezember entschied das Verfassungstribunal im Kontrollverfahren über die Richterernennung der letzten Legislaturperiode und stellte im Urteil fest, die Ernennung der drei Richter, deren Amtszeit im November 2015 anfangen sollte, sei rechtmäßig gewesen und der Präsident müsse ihnen unverzüglich den Amtseid abnehmen. Für drei der von der neuen Regierung in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember eingesetzten Richter bedeutete dies hingegen, dass sie unrechtmäßige Double waren, sozusagen Nichtrichter. Auch erklärte das Verfassungstribunal in der Entscheidung vom 9. Dezember 2015 wesentliche Bestimmungen des novellierten Gesetzes über das Verfassungsgericht für verfassungswidrig.
Doch das Verfassungstribunal hatte die Rechnung ohne die Regierung gemacht. Die für die Promulgation zuständige Premierministerin Szydło verweigerte die Publikation beider Entscheidungen im Gesetzblatt Dziennik Ustaw mit der Begründung, diese seien höchstwahrscheinlich rechtsfehlerhaft. Die hieraus resultierende Frage, ob Entscheidungen des Verfassungstribunals erst mit vollständiger Veröffentlichung in Rechtswirksamkeit erwachsen, ist unter Rechtswissenschaftlern (erst jetzt) umstritten. Der ehemalige Staatsanwalt aus der Zeit der Volksrepublik und aktuelle PiS-Abgeordnete im Sejm Piotrowicz kommentierte die Situation im März 2016 mit den Worten: "Der Souverän ist das Volk, das dem Parlament in der aktuellen Zusammensetzung die Gesetzgebung anvertraut hat. Das Verfassungstribunal besitzt eine solche Legitimierung nicht und kann sich auch nicht über das Parlament stellen." Die Entscheidungen des Verfassungstribunals warten bis heute auf ihre Veröffentlichung. Eine vergleichbare Situation ist seit Gründung des Verfassungstribunals im Jahre 1986 bislang nicht vorgekommen.
2/2: II. Umbau und Delegitimierung des Nationalen Richterrats
Im nächsten Programmpunkt der "guten Veränderung" der Judikative wurde der Nationale Richterrat (KRS) in die Mangel genommen. Der KRS ist ein Verfassungsorgan, das im Zuge der Transformationsbemühungen 1989 ins Leben gerufen wurde und dem u.a. die Überwachung der Richterausbildung und -ernennung sowie die Durchführung von Disziplinarverfahren obliegt. Wer die Kontrolle im Nationalen Richterrat hat, kann in der Richterschaft viel bewirken. Gegen einen zunächst eingebrachten, kurz darauf wieder zurückgenommenen und schließlich erneut zur öffentlichen Debatte gestellten Entwurf, der das Wesen des KRS fundamental verändern würde, ertönte aus staatlichen, regierungsunabhängigen Juristenverbänden heftigste Kritik. Uneingeschränkte politische Kontrolle durch den Sejm und die vorzeitige Entlassung der aktuellen Mitglieder des KRS – um die wichtigsten Änderungen zu nennen – seien nach Einschätzung des Beauftragten für Bürgerrechte allesamt verfassungswidrig, deren Implementierung würde "das Rückgrat der polnischen Justiz brechen". Der Oppositionsführer Grzegorz Schetyna bezeichnete die Novellierungspläne als "Bolschewisierung der Gerichte".
Der im Umgang mit Kritik seit jeher wenig souveräne PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński formulierte daraufhin in einem Interview für die regierungstreue Gazeta Polska, Richter in Polen agierten "außerhalb des Staates". Sie setzen sich mit ihren Entscheidungen über die Gewaltenteilung hinweg, denn schließlich sei die KRS auch eine "postkommunistische Organisation." Was an ihr "postkommunistisch" sein soll, wird weder in jenem Interview, noch an anderer Stelle erläutert. Bei der Äußerung dürfte es aber auch weniger um die Sachfrage gehen, als darum, bei den Lesern möglichst negative Assoziationen zu wecken und Misstrauen gegenüber dem Justizwesen zu säen.
III. Einmischung in Strafverfahren, Missachtung des Obersten Gerichts
Eine der ersten Amtshandlungen des Präsidenten nach den Wahlen 2015 bestand in der Begnadigung eines zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Parteikollegen; das (noch nicht rechtskräftig abgeschlossene) Strafverfahren gegen diesen wurde daraufhin eingestellt. Gegen diese Einstellungsentscheidung wandten sich die Nebenkläger mit einem Kassationsgesuch an das Oberste Gericht. Am 7. Februar 2017 wandte sich der zuständige Spruchkörper des Obersten Gerichts (SN) an die sog. vollständige Kammer mit zwei entscheidungserheblichen Fragen, die das Wesen des Begnadigungsrechts und dessen Rechtsfolgen betrafen. Im Beschluss vom 31. Mai 2017 stellte das SN sodann fest, das Begnadigungsrecht als Prärogative des Präsidenten könne ausschließlich gegenüber Personen verwirklicht werden, deren Schuld mit einem rechtskräftigen Urteil festgestellt wurde; die Begnadigung während eines noch laufenden Verfahrens sei hingegen eine unzulässige Einmischung in die Abläufe der Justiz.
So einfach scheint es allerdings nicht zu sein. In einer aktuellen Stellungnahme des Pressesprechers des Präsidenten heißt es erläuternd: Die Begnadigung sei nicht voreilig gewesen, "das Begnadigungsrecht des Präsidenten ist zeitlich nicht begrenzt." Zudem habe sich das SN mit einer Sache beschäftigt, in der es "keine Kompetenz hat." Unterstützend wird online eine Liste von dreizehn Stellen aus dem Schrifttum publiziert, die sich stellenweise direkt auf die Verfassung der Volksrepublik Polen beziehen, doch für ein extensives Begnadigungsrecht plädieren.
Ein enger Berater von Präsident Duda rechtfertigte den Übergriff gar mit einer biblischen Referenz: "Das Urteil des SN ist nicht die Heilige Schrift". Das mag wohl sein, aber wenn die Regierung ihren aktuellen Kurs beibehält, ist für die Justiz die letzte Messe bald gesungen.
Der Autor Oscar Szerkus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches und Internationales Privatrecht der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Doktorand am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsche und Europäische sowie Vergleichende Rechtsgeschichte der Freien Universität Berlin. Er promoviert über die Sondergerichtsbarkeit des Polnischen Untergrundstaates in der Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Oscar Szerkus, Spannungen nicht nur am Verfassungsgericht: Wie die PiS die polnische Richterschaft demontiert . In: Legal Tribune Online, 19.06.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23212/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag