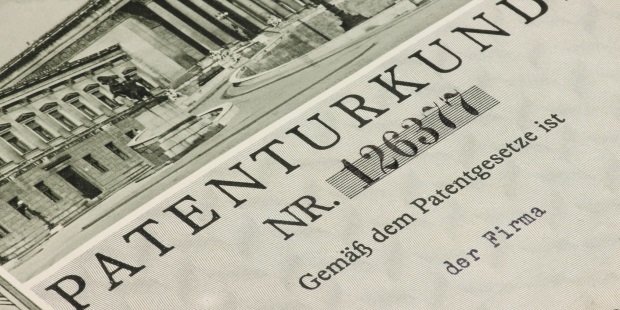Das EU-Einheitspatent wird kommen – und mit ihm die tiefgreifendste Veränderung des europäischen Patentrechts der letzten 40 Jahre. Die wesentlichen Neuerungen und Fragen für Unternehmen erläutern Matthias Meyer und Matthias Bornhäusser.
Seit der Europäische Gerichtshofs (EuGH) Anfang Mai die zweite Klage Spaniens gegen das EU-Patentpaket verworfen hat, ist die Einführung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (EU-Einheitspatent) in greifbare Nähe gerückt. Voraussichtlich ab 2016 wird in der Europäischen Union erstmalig ein Patent zur Verfügung stehen, das einen einheitlichen Schutz für nahezu alle EU-Staaten gewährleistet. Auch über die Verletzung sowie den Rechtsbestand dieses Einheitspatents entscheiden künftig nicht mehr die nationalen Gerichte, sondern das eigens hierfür gegründete "Einheitliche Patentgericht".
In erster Instanz ist die Zentralkammer in Paris, mit Außenstellen in London und München sowie mehrere Lokal- und Regionalkammern, unter anderem in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg zuständig. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben. Die Spruchkörper des Einheitlichen Patentgerichts sind international besetzt. Rechtliche Grundlage des neuen EU-Patentpakets ist unter anderem die Verordnung über das Einheitspatent sowie das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ).
EU- und EP-Patent: Gemeinsamkeiten & Unterschiede
Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung unterscheidet sich daher maßgeblich vom bekannten Europäischen Patent (sog. EP-Patent), das es auch weiterhin geben wird. Das EP-Patent ermöglicht zwar auch eine zentrale Patentanmeldung sowie ein zentrales Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Nach seiner Erteilung entfaltet es aber lediglich dieselbe Wirkung wie ein nationales Patent, gilt also nur in denjenigen europäischen Staaten, für die der Anmelder gezielt Schutz beantragt hat.
Das bisherige EP-Patent ist daher nicht viel mehr als ein "Bündel" einzelner nationaler Patente, die durch ein einheitliches Anmelde- und Erteilungsverfahren erlangt werden können. Die Rechtsdurchsetzung des EP-Patents erfolgt vor den jeweiligen nationalen Gerichten, deren Urteile regelmäßig jeweils nur in dem Land Wirkung entfalten, in dem sie ergangen sind. Ebenso können die nationalen Teile des EP-Patents nach Ablauf einer neunmonatigen Einspruchsfrist nur noch einzeln vor den jeweiligen nationalen Gerichten im Rahmen einer Nichtigkeitsklage angefochten werden.
Demgegenüber ändert sich die Rechtsdurchsetzung beim EU-Einheitspatent grundlegend. Denn das EU-Einheitspatent entfaltet in allen teilnehmenden EU-Staaten einheitliche Wirkung. Es handelt sich nur noch um ein Recht und nicht mehr um ein Bündel einzelner, nationaler Rechte.
Allerdings sollen mit der Einführung des EU-Patentsystems auch EP-Patente unter die Rechtsprechung
des Einheitlichen Patentgerichts fallen. Das gilt sowohl für EP-Patente, die bereits in Kraft sind, als auch für solche, die erst nach Umsetzung des neuen EU-Patentsystems erteilt werden. Will man dies vermeiden, besteht die Möglichkeit, für einzelne EP-Patente unter bestimmten Voraussetzungen während einer Übergangszeit ein sog. "Opt-Out" zu erklären.
Damit wird ein EP-Patent dem neuen EU-Patentsystem entzogen, was nach aktueller Planung eine Gebühr von 80 Euro pro Patent kosten soll. Eine Rücknahme des "Opt-Outs" in Form eines "Opt-Ins" soll jederzeit möglich sein. Nationale Patente sind hingegen von vorneherein nicht Teil des neuen EU-Patentsystems, sodass ein "Opt-Out" insoweit entbehrlich ist.
Besetzung des Einheitlichen Patentgerichts
Die Qualität der Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts wird eng verknüpft sein mit seiner Besetzung durch fachkundige Richter. Denn letztlich werden das neue EU-Patentsystem und seine Akzeptanz von der Qualität und Verlässlichkeit der Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts abhängen.
Die Rechtsprechung der deutschen Patentgerichte, die zu den meistfrequentierten Europas gehören, ist von hoher Qualität und genießt auch international hohe Anerkennung.
Die deutschen Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts werden in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg eingerichtet, und damit an genau den Standorten, an denen bereits jetzt die wichtigen nationalen deutschen Patentgerichte erster Instanz zu finden sind.
Die Besetzung der Lokalkammern hängt von den Fallzahlen ab. Es wird davon ausgegangen, dass jede der vier deutschen Lokalkammern auf mehr als 50 Gerichtsverfahren pro Jahr kommen wird. Dann werden zwei der drei Richterstellen an den Lokalkammern mit nationalen Richtern besetzt sein. Der dritte Richter wird aus einem internationalen Pool berufen. An den deutschen Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts werden voraussichtlich also mehrheitlich deutsche Richter tätig sein. Auf Antrag kann zudem noch ein technischer Richter hinzugezogen werden.
Abwanderung kompetenter Richter von nationalen Gerichten?
Aus dem Kreis der deutschen Patentrichter der aktuellen nationalen Patentkammern und Patentsenate ist zu vernehmen, dass viele Richterinnen und Richter ihr Interesse an einer Mitwirkung am neuen Einheitlichen Patentgericht bekundet haben. Daher könnte es zu einer Abwanderung erfahrener Richterinnen und Richter von den nationalen Kammern und Senaten an das neue Einheitliche Patentgericht kommen.
Insgesamt haben über 350 Personen ihr Interesse an einer Tätigkeit als juristischer Richter bekundet, wobei etwas mehr als 120 als "herausragend" eingestuft wurden. Nach einem weiteren Auswahlprozess ist geplant, zunächst 80 juristische Richter für das Einheitliche Patentgericht zu benennen. Hinzu kommen noch 40 technische Richter. Die Mehrzahl hiervon ist in Patentsachen erfahren. Zumindest in den Patentnationen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden ist daher von einem hohen Standard der Rechtsprechung der Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts auszugehen.
2/2: Einheitspatent kommt, falls England bleibt
Nun ist es an den Mitgliedsstaaten, das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht zu ratifizieren. Ausreichend ist die Ratifizierung durch 13 Mitgliedstaaten, inklusive Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Ernsthaft in Schwierigkeiten kommen könnte das EU-Patentpaket lediglich noch durch einen Austritt Großbritanniens aus der EU, das notwendiger Vertragsstaat des EPGÜ und Sitz der Außenstelle London der Zentralkammer ist. Nach der Wiederwahl von David Cameron hat die britische Regierung angekündigt, bis spätestens 2017 über einen Verbleib in der EU im Rahmen eines Referendums abstimmen zu lassen.
Parallel zur Ratifizierung müssen unter anderem die Richterauswahl und das Richtertraining abgeschlossen sowie die erforderliche Infrastruktur für das neue Gericht geschaffen werden. Eine endgültige Fassung der Verfahrensordnung für das Gericht ist zudem für Mitte 2015 geplant. Realistisch ist daher mit einer Einführung des neuen Patentsystems gegen Ende 2016 zu rechnen.
Danach wird sich zeigen, wie schnell sich das neue System etabliert. Wegen der Mitwirkung von Richterinnen und Richtern aus unterschiedlichen europäischen Jurisdiktionen wird es einige Zeit dauern, bis sich eine gefestigte und einheitliche Rechtsprechung herausbildet.
Entscheidung für Unternehmen: Mitmachen oder abwarten?
Wegen der grundlegenden Änderungen, die das EU-Patentpaket mit sich bringt, stellt das EU-Einheitspatent die Patentportfolio-Strategien aller auf dem europäischen Markt tätigen Unternehmen in Frage und zwingt sie, diese grundlegend zu überdenken. So muss jedes Unternehmen bei Neuanmeldungen von Patenten entscheiden, ob es ein nationales Patent, ein EP-Patent und / oder ein EU-Einheitspatent anmelden will.
Weiter müssen die Unternehmen für alle anhängigen EP-Patente entscheiden, ob sie diese in Zukunft ebenfalls vor dem Einheitlichen Patentgericht durchsetzen wollen oder ob sie insoweit ein "Opt-Out" erklären: beispielsweise kann es für ein Unternehmen durchaus sinnvoll sein, alle oder einige Patente zunächst aus dem neuen System auszuklammern, bis sich eine gefestigte Rechtsprechung entwickelt hat. Durch ein "Opt-Out" kann erreicht werden, dass ein Patent auch zukünftig nicht mit einem Schlag durch das EU-Patentgericht vollständig vernichtet werden kann. Dafür verzichtet der Patentinhaber aber auch auf die Vorteile des neuen Systems, wie etwa die Möglichkeit, ein positives Urteil für praktisch die gesamte EU in einem einzigen Rechtstreit zu erlangen.
Die Unternehmen sollten die Frage des "Opt-Out" nun zeitnah aufgreifen. Denn das "Opt-Out" ist unter anderem dann nicht mehr möglich, wenn eine Nichtigkeitsklage gegen das entsprechende Patent vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben worden ist. Dann ist der Weg aus dem einheitlichen Patentsystem endgültig versperrt. Die Frage nach einem etwaigen "Opt-Out" sollte daher vor dem Start des einheitlichen Patentsystems geklärt sein.
Die Autoren Dr. Matthias Meyer und Matthias Bornhäusser sind Rechtsanwälte im Bereich Intellectual Property bei der Kanzlei Bird & Bird LLP in Düsseldorf und beraten nationale und internationale Unternehmen insbesondere auf dem Gebiet des Patentrechts.
Dr. Matthias Meyer und Matthias Bornhäusser, LL.M., Europäisches Patentpaket: Der lange Weg zum Einheitspatent . In: Legal Tribune Online, 02.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15713/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag