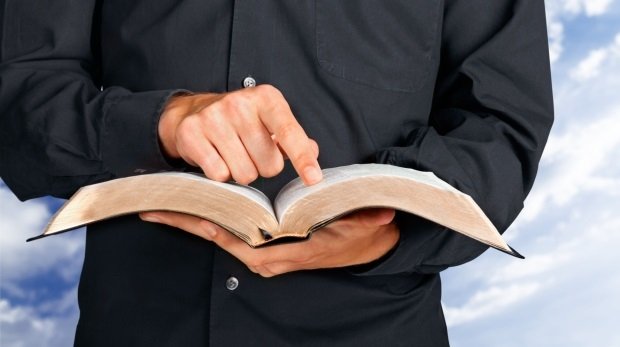Jedes Land darf - bedingt - selbst entscheiden, ob es die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkennt. Wie das BVerfG die Kompetenzen des Landes Bremens zugleich stärkt und schwächt, erläutert Thomas Traub.
Das Grundgesetz (GG) sieht für Religionsgemeinschaften eine besondere Rechtsform vor: Sie können Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung i.V.m. Art. 140 GG. Die christlichen Kirchen tragen diesen "Ehrentitel" bereits seit seiner Begründung, heute sind auch zahlreiche kleinere Religionsgemeinschaften wie z.B. jüdische Synagogengemeinden, die Heilsarmee, eine Hindu-Gemeinde und eine muslimische Gemeinschaft als Körperschaft ausgestaltet.
Doch die Zeugen Jehovas kämpfen seit Langem um ihre Anerkennung als eine solche Körperschaft. Als erstes Bundesland haben sie sich den Status bereits in Berlin vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erstritten. Im Anschluss daran haben auch viele andere Bundesländer der Religionsgemeinschaft den öffentlich-rechtlichen Status verliehen. Weniger erfolgreich waren die Zeugen Jehovas dagegen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch Bremen hatte die Verleihung des besonderen Status bislang abgelehnt.
Vor dem BVerfG hat die Religionsgemeinschaft jetzt einen weiteren Teil-Sieg errungen. Zwar hat Bremen das Recht, selbständig und unabhängig von der Anerkennung durch andere Bundesländer darüber zu entscheiden, ob es der Religionsgemeinschaft diesen Status verleihen möchte, entschieden die Karlsruher Richter. Dabei muss sich das Land jedoch an strenge Vorgaben halten. Darüber hinaus erklärte der Senat eine Vorschrift der Bremer Landesverfassung für nichtig, welche die Entscheidung über die Verleihung des Status dem Landesgesetzgeber zusprach (Beschl. v. 30.06.2015, Az. 2 BvR 1282/11).
Das BVerfG hat mit überzeugenden Argumenten die lang umstrittene Frage entschieden, ob jedes einzelne Bundesland gesondert den Körperschaftsstatus verleihen muss, oder ob hierfür bereits die Anerkennung in einem Bundesland – in diesem Falle also Berlin – ausreicht. Auch im Hinblick auf die Bindungswirkung der Entscheidungen der anderen Länder hat es eine konsequente Differenzierung getroffen, mit der aber offenbar nicht alle Richter einverstanden waren.
Die Körperschaft des öffentlichen Rechts – ein Ehrentitel?
Das grundgesetzliche Privileg einiger Religionsgemeinschaften, den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit einen gewissen hoheitlichen Status zu erhalten, hat historische Gründe. Es entstand als Zugeständnis an die christlichen Kirchen im Zuge der schrittweisen Entflechtung der vormals vereinten Institutionen Staat und Kirche seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gründung der Weimarer Republik. Sein Sinn und Wesen ist so komplex, dass er schon von einem berühmten Staatsrechtler der Weimarer Republik als "rätselhafter Ehrentitel" bezeichnet wurde.
Die praktischen Vorteile liegen dagegen auf der Hand: Neben dem im Grundgesetz ausdrücklich verankerten Recht, Steuern zu erheben, ist der Körperschaftsstatus Voraussetzung für eine ganze Reihe von gesetzlichen Sonderregeln, die über die verschiedensten Rechtsgebiete vom Straf- über das Steuer- bis zum Arbeitsrecht verbreitet sind. Daneben tritt der Imagegewinn, da viele Bürger die Bezeichnung als Körperschaft des öffentlichen Rechts als "staatlicher Gütesiegel" wahrnehmen.
Wer darf diesen Status verleihen?
Die inhaltlichen Voraussetzungen für diesen besonderen Status sind ausreichend geklärt: Die Religionsgemeinschaften müssen durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Darüber hinaus verlangt das BVerfG als ungeschriebenes Kriterium die Rechtstreue der Religionsgemeinschaft. Eine darüber hinausgehende besondere Loyalität gegenüber dem Staat ist dagegen nicht erforderlich.
Umstritten ist jedoch zum einen die Frage, ob überhaupt jedes einzelne Bundesland den Körperschaftsstatus verleihen muss, oder die Anerkennung in einem Bundesland ausreichend ist, um bundesweit alle Rechte ausüben zu können, die mit dem Status verbunden sind.
Sollte eine solche sog. "Zweitverleihung" erforderlich sein, stellt sich die zweite Frage, ob die anderen Bundesländer an die Prüfung durch das erste Land gebunden sind oder die Voraussetzungen immer wieder neu und eigenständig geprüft werden dürfen.
2/2: Länder haben eigenständige Prüfungskompetenz
Das BVerfG hat jetzt mit überzeugenden Gründen entschieden, dass jedes einzelne Bundesland entscheiden muss, ob es der Gemeinschaft den "Ehrentitel" verleihen möchte. Dabei können die Länder vor einer Zweitverleihung eine eigenständige Prüfung der geschriebenen und ungeschriebenen Voraussetzungen, unter denen der Körperschaftsstatus verliehen wird, durchführen.
Allerdings differenziert der Senat im Hinblick auf die Rechte und Kompetenzen, die aus dem Körperschaftsstatus abgeleitet werden können. Die Rechtsfähigkeit, also die Möglichkeit, am Rechtsverkehr teilzunehmen, entfaltet demnach bereits durch die Erstverleihung bundesweit Wirkung. Dies leuchtet unmittelbar ein. Auch ein Verein, der im Berliner Vereinsregister eingetragen ist, kann als juristische Person in Bremen Verträge schließen.
Etwas anderes gilt aber für die Ausübung hoheitlicher Kompetenzen, die mit dem Körperschaftsstatus verbunden sind. Dies betrifft vor allem das Besteuerungsrecht aus Art. 137 Abs. 6 WRV i.V.m. Art. 140 GG oder die Dienstherrenfähigkeit, also die Befugnis, statt Arbeitnehmern Beamte zu beschäftigen. Diese kann ein Land nicht mit Wirkung über seine Grenzen hinaus verleihen.
Dieses Ergebnis beachtet konsequent die Eigenstaatlichkeit der Länder sowie die Besonderheiten, die sich aus dem Bundesstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG ergeben. Gleichzeitig betont die Entscheidung die Grenzen der Prüfungskompetenz der Länder: Denn die Befugnis einer Religionsgemeinschaft, in Bremen Hoheitsgewalt auszuüben, kann nicht ausschließlich von einer Beurteilung durch das Land Berlin abhängen. Dies gilt vor allem für die ungeschriebene Voraussetzung der Rechtstreue, die sich nicht mit mathematischer Genauigkeit berechnen, sondern nur im Rahmen einer komplexen Prognose bewerten lässt.
Sondervotum: Künstliche Aufspaltung nicht erforderlich
Zu einem ganz anderen Ergebnis kommt allerdings eine abweichende Meinung, die drei Richter des BVerfG, u.a. dessen Präsident, Andreas Voßkuhle, vertreten. In ihrem Sondervotum verneinen sie schon, dass überhaupt jedes Bundesland gesondert über die Anerkennung der Religionsgemeinschaft entscheiden muss.
Da der Körperschaftsstatus, seine rechtlichen Voraussetzungen und auch das Besteuerungsrecht im Grundgesetz als Verfassung des Bundes geregelt seien, müsse der Akt der Verleihung durch ein Land im ganzen Bundesgebiet Geltung beanspruchen können.
Die Minderheit im Senat kritisiert sehr deutlich die Differenzierung der Senatsmehrheit zwischen der bundesweiten Anerkennung der Rechtsfähigkeit als juristische Person und der auf die Landesgrenzen beschränkte Ausübung der Hoheitsgewalt als künstliche Aufspaltung des Verleihungsverfahrens.
Eine Sache der Exekutive, nicht der Legislative
Obwohl der Senat mehrheitlich und damit verbindlich die Prüfungskompetenzen der Länder gestärkt hat, muss Bremen in einem anderen Punkt der Entscheidung eine Niederlage hinnehmen. Art. 61 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen sieht vor, dass der Körperschaftsstatus einer Religionsgemeinschaft durch förmliches Gesetz verliehen wird. Diese Norm verstößt gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung, wie er sich aus Art. 20 Abs. 2 GG ergibt, und ist daher nichtig, so die Verfassungsrichter. Die Verleihung des Körperschaftsstatus sei nämlich eine klassische Einzelfallentscheidung, die funktional der Verwaltung vorbehalten sei. Bereits indem es die falsche Form des Verfahrens wählte, hat das Land Bremen die Grundrechte der Zeugen Jehovas verletzt.
Die Erkenntnis, dass es die Aufgabe der Verwaltung und nicht des parlamentarischen Gesetzgebers ist, den Körperschaftsstatus zu verleihen, setzt sich auch in anderen Bundesländern durch. So traf auch in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung diese Entscheidung, basierend auf dem im Jahre 2014 erlassenen Körperschaftsstatusgesetz.
Damit liegt es nun nicht mehr an der Bremischen Bürgerschaft, sondern an der Verwaltung, über den Antrag der Zeugen Jehovas zu entscheiden. Und obwohl das BVerfG dem Land Bremen eine Prüfungskompetenz eingeräumt hat, erscheint das Ergebnis dennoch voraussehbar. Die Verwaltung hat keinen Entscheidungsspielraum, keine politische Gestaltungsfreiheit, sondern ist strikt an die Prüfung der Voraussetzungen gebunden, die sich aus dem GG ergeben. Dass sich nun in Bremen Hinweise für einen systematischen Mangel an Rechtstreue der Zeugen Jehovas finden lassen, die bislang von allen Gerichten und den Verwaltungen von 13 Ländern übersehen wurde, wäre doch sehr überraschend.
Das ungeminderte Interesse verschiedener Religionsgemeinschaften am Körperschaftsstatus und der effektive Rechtsschutz, den das BVerfG erneut gewährt, zeigen vor allem: Der "rätselhafte Ehrentitel" für Religionsgemeinschaften wurzelt in der Vergangenheit, wird aber seine Bedeutung auch in Zukunft nicht verlieren.
Der Autor Thomas Traub ist Lehrbeauftragter an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Zuvor war er Akademischer Rat am Institut für Kirchenrecht der Universität Köln.
Thomas Traub, BVerfG zum Körperschaftsstatus der Zeugen Jehovas: Bremen darf selbst entscheiden . In: Legal Tribune Online, 14.08.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16617/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag