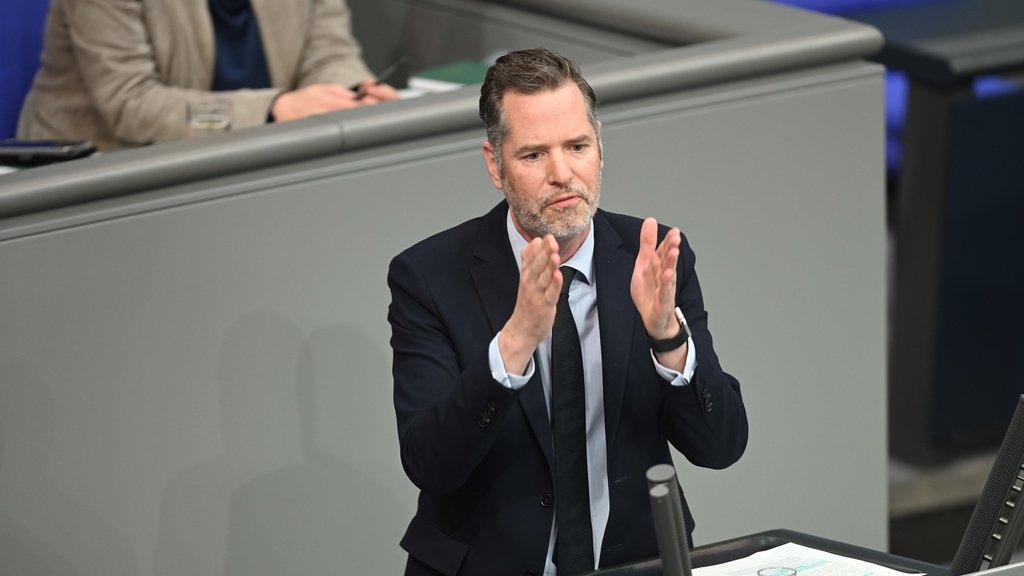Nach Erdogans Strafverlangen war in der öffentlichen Meinung schnell klar: Der "Schah-Paragraph" gehört abgeschafft. Eine erfreuliche Entkriminalisierungsdebatte, findet Alexander Heinze. Nur leider aus den völlig falschen Gründen.
Künstler und Prominente solidarisieren sich mit Jan Böhmermann. Sie fordern in der Zeit in einem Aufruf sogar die Staatsanwaltschaft Mainz dazu auf, nicht mehr gegen den Comedian zu ermitteln. Nicht ganz so einhellig bewerten die ersten rechtwissenschaftlichen Analysen die Situation des Satirikers. Einig ist die Öffentlichkeit sich aber mit tonangebenden Medienvertretern und gar solchen der mitregierenden SPD: 103 Strafgesetzbuch (StGB) gehört abgeschafft.
Das Bundesjustizministerium zeigt sich nach Medienangaben zurückhaltend, es gebe bislang keine offizielle Prüfung. Auch die Bundesregierung ließ am Mittwoch verlauten, man werde die politisch heikle Entscheidung um die Verfolgungsermächtigung nicht durch eine rasche vorherige Abschaffung des "Schah-Paragraphen" umgehen.
Übrige bliebe dann nur noch die normale Beleidigung nach § 185 StGB, wegen der die Staatsanwaltschaft Mainz nach dem Strafantrag des türkischen Präsidenten ohnehin ermittelt. Die hält die öffentliche Meinung für ausreichend; die antiquierte und heute nicht mehr vermittelbare "Majestätsbeleidigung" könne, ohne Schutzlücken zu hinterlassen, abgeschafft werden. Als "Überrest aus obrigkeitsstaatlichen und monarchischen Zeiten" bestehe für eine schwerer wiegende Beleidigung eines Staatsmanns gegenüber jener "anderer Menschen" im 21. Jahrhundert kein Bedürfnis mehr, so zum Beispiel Politik-Chef und Jurist Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung.
Warum wir strafen: der Schutzzweck von § 103 StGB
Wenn die jetzige Debatte über die Behandlung des Böhmermann-Gedichts zu einer Entkriminalisierungsdebatte wird, ist das aus strafrechtstheoretischer Sicht erfreulich. Die aktuelle Diskussion verkennt aber, dass bei der Forderung nach Abschaffung einer Strafnorm deren Schutzgedanke nicht ganz aus den Augen verloren werden sollte. Die Publikumspresse wie auch die ersten Ausführungen in der Fachpresse setzen sich nämlich fast ausschließlich mit dem Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und staatlichem Strafverfolgungsinteresse aufgrund ehrverletzender Äußerungen auseinander. Stattdessen muss, wer die Entkriminalisierung eines derzeit unter Strafe stehenden Verhaltens fordert, sich mit der Frage beschäftigen, warum das Verhalten aktuell pönalisiert ist.
In erster Linie stellen wir ein Verhalten unter Strafe, um tatsächliche oder potentielle Beeinträchtigungen der Interessen anderer zu verhindern oder um Rechtsgüter zu schützen. § 103 StGB soll Ehrverletzungen ausländischer Staatsoberhäupter abwenden. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass das Staatsoberhaupt seinen Staat verkörpert. Die Strafnorm soll also ausländische Staaten vor Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit schützen. Der in den vergangenen Tagen allgemein bevorzugten Lesart, der Paragraph sei ein Relikt der Majestätsbeleidigung, zieht das übrigens wohl eher den Zahn. Auch die Behauptung, dass bei Abschaffung des § 103 StGB keine Schutzlücke entstünde, da der Ehrschutz ja über § 185 StGB gewährleistet sei, ignoriert dieses Rechtsgut der Norm.
Als weiteres Rechtsgut soll diese auch das Interesse Deutschlands an einem Mindestbestand funktionierender Beziehungen zu ausländischen Staaten schützen. Es ist Bedingung der Strafbarkeit, dass die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen zu dem betroffenen Staat unterhält.
Kollektive Rechtsgüter in der öffentlichen Wahrnehmung
Bei kollektiven Rechtsgütern ist die öffentliche Wahrnehmung grundsätzlich eine andere als bei Leben, Eigentum oder körperlicher Unversehrtheit. Die Meinungen darüber, wie schützenswert kollektive Rechtsgüter sind und ob ihre Verletzung geahndet werden muss, scheinen häufig auseinander zu gehen.
Ein Beispiel dafür ist die unterschiedliche Behandlung von Drogen- und Waffenbesitz: Während bei ersterem die öffentliche Meinung zu einer Legalisierung tendiert, spricht sie sich bei der Frage des Waffenbesitzes eher für eine Verschärfung bestehender Gesetze aus.
Dabei sind – zumindest aus Sicht der Strafrechtstheorie – die Fragen, die sich bei einer Kriminalisierung dieser Verhaltensweisen stellen, beinahe identisch: Es sollen kollektive Rechtsgüter geschützt werden durch das Verbot einer Handlung, obwohl wir nicht einmal sicher sind, wie wahrscheinlich es ist, dass das Verbot seines Besitzes den Drogenkonsum und Schusswaffengebrauch tatsächlich reduziert.
2/2: Gründe für eine Entkriminalisierung, die in der Diskussion nicht vorkommen…
Vor allem Staatsschutzdelikte werden als diffus und schwer greifbar wahrgenommen. Dennoch sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, ihnen von vornherein die Strafwürdigkeit abzusprechen.
Nichts spricht per se dagegen, die Handlungsfähigkeit anderer Staaten und die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zu diesen über das Strafrecht zu schützen. Oder, um es mit dem aus dem anglo-amerikanischen Recht stammenden Kriminalisierungsgrund zu beschreiben: § 103 StGB soll Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abwenden.
Natürlich kann man diskutieren, ob die Vorschrift dazu tatsächlich geeignet ist. Vielleicht auch, ob die Handlungsfähigkeit eines anderen Staates bzw. die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zu diesem wirklich (strafrechtlich) schützenswert sind. Beides kann ein Grund für eine Entkriminalisierung sein. In der öffentlichen Diskussion über die Abschaffung der Vorschrift findet dieser Strafzweck aber so gut wie keine Erwähnung.
… und andere, die falsch verwendet werden
Ein zweiter Grund, ein Verhalten in Zukunft nicht mehr unter Strafe zu stellen, wäre, dass man dieses einfach nicht für verwerflich hält. So sehr in der Strafrechtstheorie darüber auch gestritten wird - im Bewusstsein der Bevölkerung spielt der Verwerflichkeitsgedanke weiterhin eine große Rolle. Also: Hat sich der Täter verwerflich und unmoralisch verhalten, muss er bestraft werden.
Und hat Jan Böhmermann das getan? Intuitiv möchte man antworten: Nein, das muss doch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Diese Argumentation wäre jedoch ein Zirkelschluss und beantwortet die Frage nicht.
Die Verwerflichkeit beurteilt sich nämlich unabhängig davon, ob dieses Verhalten – dann auf einer zweiten Stufe – von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Anders gesagt: Böhmermanns Verhalten kann verwerflich und trotzdem von der Meinungsfreiheit gedeckt sein.
Hat Jan Böhmermann sich verwerflich verhalten?
Und ist Böhmermanns Verhalten moralisch verwerflich? Beim Versuch einer Antwort spielt der Gedanke des Respekts für eine andere Person eine große Rolle. Außerdem tendieren wir unbewusst dazu, ein Verhalten als verwerflich anzusehen, von dem wir wissen, dass es unter Strafe steht (aber nur dann bestraft werden soll, wenn es verwerflich ist).
Aus diesem Gedankenkarussell heraus hilft eine Reise auf den Kinderspielplatz: Würde dort ein Kind zum anderen Kind inhaltlich etwa das sagen, was Böhmermann mit seinem Gedicht ausdrückt, würden die Eltern ihm mit erhobenem Zeigefinger zu verstehen geben, dass so etwas nicht richtig ist und dass es sich entschuldigen soll? Sie würden es jedenfalls kaum dazu ermuntern, weiterzumachen, mit Verweis auf seine Meinungsfreiheit.
Es gibt gute Gründe dafür, das Verhalten Böhmermanns als verwerflich einzustufen –der Schutz durch die Meinungs- oder Kunstfreiheit ändert, selbst wenn man ihm einen weiten Anwendungsbereich einräumen wollte, an dieser Verwerflichkeit nichts. Also kann § 103 StGB nicht mangels Verwerflichkeit Böhmermanns Verhaltens abgeschafft werden.
Kriminalisierung ist kein Versandhandel
Eventuellen Überkriminalisierungstendenzen hat der Gesetzgeber dadurch Rechnung getragen, dass er die Verfolgung von Verhalten wie das von Böhmermann durch die Prozessvoraussetzung in § 104a StGB in das Ermessen der Bundesregierung gestellt hat.
Es ist kaum zu erwarten, dass die Entscheidung der Regierung im Fall Böhmermann der Debatte um die Abschaffung des 103 die notwendige Kurskorrektur verleiht: Bejaht die Regierung ein Strafverfolgungsinteresse, wirkt das, als trage sie zu einem Eingriff in die Meinungsäußerungs- und Kunstfreiheit bei, die als verfassungsrechtlich verankertes Grundrecht auch für die Kriminalisierungsfrage eine Rolle spielt, wenn auch nicht, wie meist in der aktuellen Diskussion, die einzig maßgebliche. Willigt die Regierung nicht in eine Strafverfolgung ein, wird die Frage nach dem übrig bleibenden Anwendungsbereich der Vorschrift gestellt werden.
Es ist schade, dass eine im Grunde genommen erfreuliche Debatte durch Empörung so emotional aufgeladen ist, dass sie künstlich zu einem Showdown zwischen der Meinungsfreiheit in einer aufgeklärten Gesellschaft einerseits und einer aus einer entfernten dunklen Zeit stammenden Strafnorm andererseits gemacht wird. Dass 103 StGB mit Verweis auf das Etikett der veralteten Majestätsbeleidigung entsorgt werden soll, entbehrt nicht einer gewissen Ironie in einer Debatte, in der das Hinterfragen der Verfassung als Alleinstellungsmerkmal in Kriminalisierungsfragen seinerseits quasi als Majestätsbeleidung angesehen wird.
Kriminalisierung ist kein Versandhandel. Und Strafnormen sind nicht dazu geeignet, zurück geschickt zu werden, wenn es erste Anzeichen dafür gibt, dass sie einem nicht mehr gefallen. Gegner der Kriminalisierung des Besitzes von Cannabis kämpfen seit Jahren für eine Legalisierung, weil es – unter anderem – gute Gründe gibt, zu argumentieren, dass der Cannabis-Konsum moralisch nicht verwerflich ist.
Dass in der Causa Böhmermann eine drohende Verletzung der Meinungs- oder Kunstfreiheit in einem Einzelfall nach nur wenigen Tagen eine Debatte um die Existenzberechtigung des § 103 StGB auslöst, ohne dass auch nur über dessen Strafgrund nachgedacht wird, zeigt, wie einseitig die Diskussion geführt und wie bereitwillig jede strafrechtliche Wertediskussion der Diskussion um verfassungsrechtlich verankerte Freiheiten geopfert wird.
Der Autor Dr. Alexander Heinze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kriminalwissenschaften in der Abteilung für ausländisches und internationales Strafrecht an der Universität Göttingen.
Dr. Alexander Heinze, Der 'Schah-Paragraph' § 103 StGB: Bei Nichtgefallen Gesetz zurück . In: Legal Tribune Online, 15.04.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19087/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag