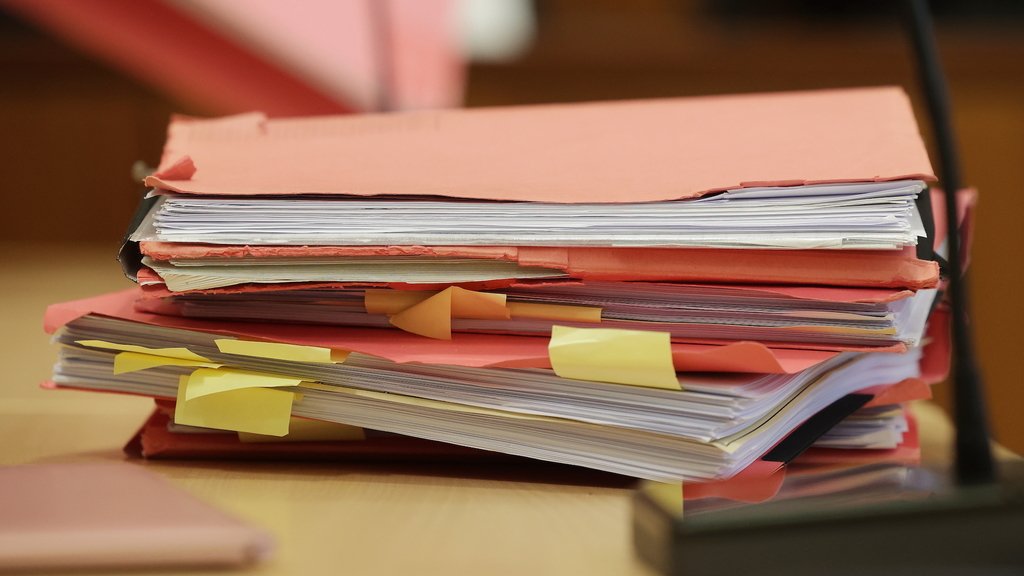Die Vereinten Nationen haben den 15. Oktober zum Welttag des Händewaschens erklärt. Zum Nachdenken über symbolische Formen im Recht laden saubere Hände jedenfalls auch ein. Von Martin Rath.
Ein Wehklagen gibt es über die starke Präsenz von antiken Fax-Geräten oder die schleichende Einführung von digitalen Dienstpostfächern. Einerseits leidet die deutsche Justiz gar nicht selten unter sich selbst, wenn es um ihre Schwierigkeiten geht, den Geschäftsverkehr ebenso elektronisch abzuwickeln wie es andere Branchen vormachen.
Andererseits fragt sich, wohin das noch alles führen soll. In jedem Jahr schreiten nach wie vor tausende junger Leute durch die Pforten der juristischen Fakultäten, um sich dort wie ein i-Dötzchen in Hogwarts zu fühlen, verzaubert von den Möglichkeiten der Rechtswissenschaft und in der Hoffnung, dass sie dermaleinst mit den Staatsprüfungen keinen Bethlehemitischen Kindsmord erleben müssen.
Performatives Handeln in der digitalen Welt?
Was wird erst geschehen mit den unzähligen richteramtlich Befähigten in diesem Land, wenn auch Privatleute ihre Verträge, mehr noch als heute, elektronisch vor- und aufbereiten lassen und noch das kleinste Unternehmen bei Änderungen der Rechtslage den automatischen Hinweis auf die notwendigen Vertragsanpassungen erhält? Auch von der Betriebswirtschaftslehre her weht da ein kalter Wind, hält man dort den juristischen Blick auf den Vertrag doch mitunter für vertrauens- und damit geschäftsschädigend.
Eine – zugegeben subjektive – Vermutung: Neben der Beratung wird die darstellerische Leistung belohnt werden. Allgemeiner formuliert: Die performativen Leistungen, die sich nicht durch digitale Surrogate verdrängen lassen, könnten an Wert gewinnen. Bestimmt tröstet Sie, liebe Leserin, verehrter Leser, dieser Gedanke: Vielleicht müssen Artikel wie der vorliegende dann vom Autor eurythmisch vorgetanzt werden statt sie bloß aufzuschreiben – denn Schreiben kann die Künstliche Intelligenz dann vermutlich auch schon ganz alleine.
In den juristischen Berufen hat das Performative ja schon immer seinen Rang behalten, man denke da ans Aufstehen des Publikums vor dem Gericht oder die schicke Dienstbekleidung.
Statt Normenketten: Händewaschen
Wie leistungsfähig das performative Handeln ist, zeigt ein Blick auf den folgereichsten Strafprozess der Weltgeschichte, überliefert beim Evangelisten Matthäus (27, 24): "Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache."
Bei der Urteilsbegründung wird man etwas ins Zweifeln geraten müssen, doch die Darbietung war sehr eindrucksvoll: Mit der performativen Übung des Händewaschens wurde erklärt, wozu das deutsche Recht gleich eine Vielzahl von Normen benötigt, vom jeweiligen dogmatischen Überbau gar nicht zu reden. Zum Beispiel drückte der römische Richter hier etwas aus, was sich inzwischen in § 839 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) findet: das berühmte Spruchrichterprivileg.
Um für das eigene richterliche Handeln dann auch noch das Volk statt die eigene Person in symbolische Haftung zu nehmen, benötigt das deutsche Recht heute gleich in jeder Prozessordnung eine eigene Vorschrift zum "Namen des Volkes": §§ 311 Zivilprozessordnung, 268 Strafprozessordnung, 117 Verwaltungsgerichtsordnung und viele andere mehr.
Vor der weiteren Auflösung dieser etwas vorwitzigen These sprechen wir doch kurz von der mehr alltagspraktischen Dimension dessen, was Pontius Pilatus da prozessual verrichtete: nämlich vom Händewaschen.
Händewaschen als Frage des positiven Rechts
Die symbolische Bedeutung des Händewaschens ist naturgemäß in der neueren Rechtsprechung stark verblasst. Am nächsten kommt ihr, wie könnte es anders sein, das Bundesverfassungsgericht.
Im Rahmen von Protesten gegen die Spedition von Atommüll durch Niedersachsen ("Castor-Transporte") war eine Bürgerin nach einer Sitzblockade am 13. November 2001, 10.20 Uhr, von der Polizei in Haft genommen, am 14. November um 8.23 Uhr entlassen worden.
Neben den wirklich grässlichen Umständen der Freiheitsentziehung, die zunächst mit vier Personen in einer nur zwei Quadratmeter großen Zelle erfolgt war, wurde nach drei Stunden die Benutzung einer Toilette erlaubt. Ein Umstand, der durch die fehlende Gelegenheit zum Händewaschen aber auch gleich wieder entwertet wurde (BVerfG, Beschl. v. 13.12.2005, Az. 2 BvR 447/05).
Bewerten wir das einmal vorsichtig: Obwohl die Anti-Atomproteste dem Konzept des zivilen Ungehorsams folgten, das einen Bruch positiven Rechts in Kauf nimmt und von seinem bekanntesten Vertreter, Mohandas K. Gandhi (1869–1948) mit dem Prinzip verbunden wurde, die staatliche Repression gelassen zu ertragen, ist hier die verweigerte Handwaschung ein Problem, das verfassungsrichterliche Aufmerksamkeit verlangt.
Zum Vergleich mag ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg dienen. Im Streit stand die Frage, ob das Krebsleiden des Klägers als Berufskrankheit anerkannt werden müsse. Den Hintergrund für die ablehnenden Entscheidungen der Berufsgenossenschaft sowie der Gerichte bildet hier unter anderem eine Praxis des Händewaschens mit benzolhaltigen Treibstoffen, die von Arbeitern in technischen Berufen erwartet oder unter ihnen jedenfalls geduldet wurde – das Gericht ordnet sie dem widerwärtigen Menschenverschleiß in den chemischen Betrieben der früheren DDR gleich (LSG, Urt. v. 26.09.2013, Az. L 6 U 1510/12).
2/2: Kein Mitleid mit dem schmutzigen Teil Kölns?
Im bayerischen Beamtenrecht soll es nach Auffassung der Staatsregierung bei Anerkennung eines Dienstunfalls darauf ankommen, ob eine Lehrerin die Schultoilette zu dienstlichen Zwecken aufgesucht hat, um ihre Hände von Süßgetränk-Spuren eines Schülers zu reinigen (VGH Bayern, Beschl. v. 24.02.2015, Az. 3 ZB 13.1706).
Der Europäische Gerichtshof bestätigte österreichischen Lebensmittelunternehmen, dass man es mit den technischen Vorrichtungen zum Händereinigen auch übertreiben könne (Urt. v. 06.10.2011, Az. Rs. C-381/10) und reichte damit den in Österreich so stark vertretenen Europaskeptikern gleichsam die Hand.
Schließlich kann sich in Fragen des Händewaschens die Haltung gegenüber der näheren Nachbarschaft des Gerichtssitzes ausdrücken: Im April 1971 verteilte eine Firma rings um das Gebäude des Oberlandesgerichts Köln am Reichenspergerplatz 1.500 Warenproben-Beutel, die unter anderem ein 60-Gramm-Stück "banner"-Seife enthielten. Dies missfiel neben einem Wettbewerber auch dem Landgericht und dem OLG Köln sowie dem BGH, die darin eine unlautere Werbeaktion sahen. Immerhin seien 60 Gramm Seife viel zu viel, um sich bloß mittels ein- oder zweimaligen Händewaschens einen ersten Eindruck von der Qualität des Produkts zu machen (BGH, Urt. v. 14.06.1974, I ZR 105/73).
Das richterliche Judiz mag dabei ein bisschen pikant gewesen sein: Während das sogenannte Agnesviertel rund um das Gericht heute eine der angesagten und teuren Wohngegenden Kölns ist, galt es damals als schmutzig und prostitutionsgeneigt, immer noch kriegsbeschädigt und voller grässlich unmoderner Gründerzeitbauten. Wer da eine Seifenverteilung nicht als Provokation sah, kannte die etwas ungewaschene Nachbarschaft seines Gerichts nicht.
Handhygiene mit Niklas Luhmann
Zwar reichen die mit Fragen der Handhygiene verbundenen Angelegenheiten sicher nicht, um gleich einen ganzen Fachanwaltsberuf zu kreieren, was in anderen Anliegen ja durchaus kein schlechter Probierstein auf die Relevanz einer sozialen Problematik ist.
Dass es sich bei der Sorge um die Sauberkeit der Hände um ein Problem höchster Bedeutung handeln kann, wurde jedoch durch die Weigerung von zwei muslimischen Knaben wahabitscher Observanz bekannt, ihrer Lehrerin den in der Schweiz üblichen Handschlag zu geben. Offenbar spielt hier eine Art theologische Hygiene-Theorie hinein, aufgrund derer sich Männer vor potenziell menstruierenden Frauen fürchten müssen.
Wenn überhaupt verfassungsrechtlich, so wurde dies hierzulande in den üblichen grundrechtsfixierten Bahnen diskutiert. Das ist, wenn man eine vereinfachte Idee der Systemtheorie Luhmanns zugrunde legt, ein bisschen schade.
Die beiden Kammern des britischen Parlaments machen es vor, wie sich weltanschauliche Differenzen in differenzierende Staatsorganisationspraxis überführen lassen: Zu Beginn der Legislaturperiode sind die Abgeordneten des Unterhauses gehalten, einen Treueeid auf die Königin zu leisten – abgesehen von Atheisten unter Verwendung einer heiligen Schrift.
Die gewählten Vertreter der irisch-republikanischen Partei "Sinn Fein" weigern sich traditionell, der alten Dame aus dem hannöverschen Landadel die Treue zu schwören. Deshalb dürfen sie dann im Parlament eben auch nicht mitspielen.
Mal schauen, ob die Symbole wieder wichtiger werden
Ob man von wahabitischen Knaben in der Schweiz die gleiche Bereitschaft erwarten darf, sich wegen der Weigerung einer symbolischen Handlung aus einem staatlichen Subsystem (Schule) exkludiert zu sehen wie den irischen Königshaus-Hassern im House of Commons, sei einmal dahingestellt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man gegen die atomstaatliche Obrigkeit zivilen Ungehorsam leistet, aber empfindlich wird, wenn man nach dem Gang aufs Polizei-WC keine Gelegenheit zum Händewaschen bekommt.
Eines wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aber vermutlich doch sehr interessant werden: Ob mit dem enormen Zuwachs an technologischer Effizienz in den juristischen Tätigkeitsgebieten eine Renaissance der symbolischen Ausdrucksformen einhergehen wird – und damit nicht zuletzt die Bereitschaft, die Inklusion in staatliche Institutionen stärker als bisher (wieder) an performative, expressive Handlungsformen wie Eid, Handschlag oder ähnliche rituelle Praktiken zu binden.
Der Autor Martin Rath arbeitet als freier Lektor und Journalist in Ohligs.
Martin Rath, Hygiene als juristischer Streitfall: Händewaschen aus Rechtsgründen . In: Legal Tribune Online, 16.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20870/ (abgerufen am: 10.05.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag