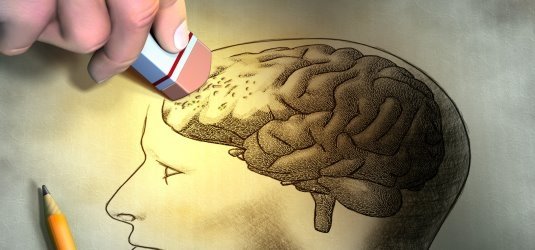Vor genau einem Jahr entschied der EuGH, dass Suchmaschinen die Pflicht haben, Suchergebnisse zu löschen, wenn diese Persönlichkeitsrechte Betroffener verletzen. Hannes Rösler blickt auf die Entwicklung seitdem zurück und spricht über sein Unbehagen angesichts der Marktmacht der Suchmaschine – aber auch über die schwierige Lage, in die der EuGH das Unternehmen versetzt hat.
LTO: Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Recht auf Vergessenwerden im Internet gehört zu den meist diskutierten des Gerichts. Was halten Sie davon, nachdem Sie die praktischen Auswirkungen nun ein Jahr lang beobachten konnten?
Rösler: Tatsächlich ist die weitgehend als überraschend empfundene Entscheidung gerade in Deutschland mit starken Reaktionen aufgenommen worden. Von der Rückkehr des Rechts, gar einer Rettung gemeineuropäischer Rechtskultur im Internet war die Rede. Vereinzelte Kommentatoren fürchteten dagegen eine Zensur eines – nun privaten – "Ministry of Truth" à la George Orwell in 1984.
Zunächst einmal ist das Schlagwort "Recht auf Vergessenwerden" irreführend, denn das Urteil fordert kein vollständiges Vergessen. Nur die Verlinkungen in der Ergebnisliste der Suchmaschine sollen entfallen. Die Informationen sind auf den Seiten und in den Archiven oder über Verlinkungen in Blogs grundsätzlich weiterhin auffindbar.
In Bezug auf die Meinungsfreiheit macht das durchaus einen Unterschied. Das Internet ist eben prinzipiell dezentral. Allerdings dürften die Informationen angesichts von Googles Marktmacht nun in den allermeisten Fällen nicht mehr gefunden werden. So gesehen besteht beim Einstieg faktisch doch eine Zentralität. Für einen erfolgreichen Löschungsantrag müssen die veröffentlichten Inhalte übrigens selbst nicht rechtswidrig sein.
Inhaltlich finde ich das Urteil durchaus nachvollziehbar. Informationen sind im Internet überall abrufbar. Dieses Medium vergisst eigentlich nichts. Das Recht auf Vergessenwerden ist die Reaktion darauf. Wenn man sich gelöschte Links anschaut, in denen es beispielsweise um Vergewaltigungsopfer geht, kann ich gut verstehen, warum das Urteil überwiegend begrüßt wurde.
Aus europäischer Sicht ist die Klarstellung des EuGH erfreulich, dass Googles spanischer Ableger dem EU-Datenschutzrecht unterliegt. Die europäischen Niederlassungen sind also an das europäische Datenschutzrecht gebunden.
Dennoch wirkt die Entscheidung in der Sache zwiespältig. Das Internet wird zunehmend das Archiv unserer Zeit, quasi unser kollektives Gedächtnis. Und man überlässt mit Google – dem vielleicht mächtigsten privatwirtschaftlichen Unternehmen der Gegenwart – die Entscheidung, welchen Zugang zu welchen Informationen der Internetnutzer effektiv haben soll. Das Missbrauchspotenzial ist prinzipiell kaum zu unterschätzen. Ich habe ein Unbehagen angesichts der starken Vermittlerrolle Googles bei der Verwaltung unseres kollektiven Gedächtnisses und seiner Marktstellung, die ja von der EU-Kommission derzeit kartellrechtlich untersucht wird.
"Links auf Fotos, die heute nur ein bisschen peinlich sind, sollen nicht gelöscht werden"
LTO: Der Lösch-Beirat, bestehend aus acht Experten, die monatelang getagt haben, um Kriterien für die Behandlung der Lösch-Anträge zu finden, hat sich im Februar 2015 nur auf grobe Empfehlungen einigen können. Könnten Sie diese kurz skizzieren?
 Rösler: Interessant ist, dass sich die Experten nicht wirklich haben einigen können. Während sich sieben Experten mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, dass Suchmaschinen sich im Zweifel für das Löschen entscheiden sollten, hat der Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales sich in seinem Sondervotum gänzlich gegen das Recht auf Vergessenwerden ausgesprochen und den europäischen Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert.
Rösler: Interessant ist, dass sich die Experten nicht wirklich haben einigen können. Während sich sieben Experten mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, dass Suchmaschinen sich im Zweifel für das Löschen entscheiden sollten, hat der Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales sich in seinem Sondervotum gänzlich gegen das Recht auf Vergessenwerden ausgesprochen und den europäischen Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert.
Der von der Mehrheit getragene Bericht spricht von keiner simplen Formel. Es komme auf die Abwägung aller Umstände im Einzelfall an. Das ist nachvollziehbar, denn auch das deutsche Persönlichkeitsrecht ist Fallrecht reinsten Wassers. Jeder bei Google eingereichte Antrag ist weiterhin individuell zu bewerten. Dafür haben sie einen Kriterienkatalog aufgestellt, an dem sich die mit der Rechtsfrage Befassten orientieren sollen.
Wichtig ist dabei vor allem der Zeit-Faktor. Wie weit liegt die Information, über die berichtet wurde, in der Vergangenheit? Je länger das Ereignis zurückliegt, desto größer kann das Interesse an einer Löschung der Verlinkung sein. Relevant ist zudem die die öffentliche Funktion des Antragstellers – hochrangige Beamte oder Politiker müssen sich mehr gefallen lassen als Privatpersonen. Schließlich geht es um die Bedeutung der Information für die öffentliche Diskussion. Links auf selbst gepostete Fotos, die jemand kurze Zeit danach bloß ein bisschen peinlich findet, sollten jedenfalls nicht gelöscht werden.
Bei Straftaten wiegt das Löschverlangen des Opfers schwer. Aber auch der Täter kann dies verlangen, wenn er dadurch seine Chance zur Resozialisierung gefährdet sieht. Dann spielt neben den obigen Kriterien natürlich auch die Schwere der Tat eine Rolle.
"Ein öffentliches Gremium könnte besser entscheiden als Google"
LTO: Wie stehen Sie zu dem Vorschlag des Lösch-Beirats, Google solle sich im Zweifel für die Löschung entscheiden? Setzt das im Hinblick auf die Meinungsfreiheit im Internet nicht fatale Anreize?
Rösler: Tatsächlich gibt der EuGH Google einen Anreiz, den Löschanträgen zu folgen, um dem Risiko etwaiger Klagen zu entgehen. Diese klare Empfehlung wirkt nun aber noch mehr in die falsche Richtung. Ich hätte es bevorzugt, wenn der EuGH und der Beirat sich im Zweifel für die Meinungsfreiheit ausgesprochen hätten. Nun kann man nur hoffen, dass diejenigen, die bei dem Unternehmen entscheiden, die Meinungsfreiheit hinreichend berücksichtigen.
LTO: Und was wäre, wenn jemand anderes als Google die Entscheidung treffen würde? Ein öffentliches Gremium oder ein Gericht?
Rösler: Google hätte es sicherlich nicht gerne, dass man ihnen die Entscheidung aus der Hand nimmt. Ich halte den derzeitigen Ansatz für praktikabel. Gerichte sind tendenziell überlastet. Sollte der Ansatz aber nicht zu überzeugenden Resultaten führen, wäre auch ein öffentliches Gremium, besetzt mit Experten auf dem Gebiet als Alternative zu Google denkbar. Würde dagegen eine Behörde entscheiden, stünde rasch der Vorwurf der staatlichen Zensur im Raum.
Anne-Christine Herr, Ein Jahr Recht auf Vergessenwerden: . In: Legal Tribune Online, 13.05.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15529 (abgerufen am: 27.07.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag