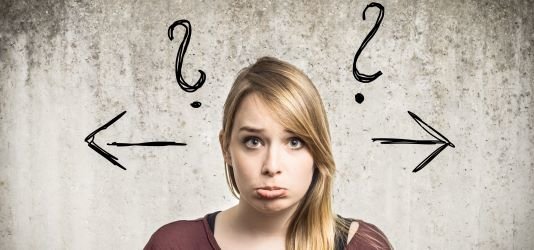Jahrelang dachten alle, der für Juristen charakteristischste Satzanfang sei "Es kommt darauf an…" Falsch gedacht. Eine südamerikanische Studie von Computerlinguisten hat schon 2011 gezeigt, dass man Volljuristen verlässlich identifizieren kann, indem man die Häufigkeit von "Etwas anderes gilt, wenn…" in ihren Äußerungen nachzählt. Roland Schimmel findet das gar nicht überraschend.
"Etwas anderes gilt, wenn …" kündigt eine Ausnahme an, wo bisher von der Regel die Rede war. Was eine Regel und was eine Ausnahme ist, weiß jeder, der selbst einmal Kind war. Oder Kinder hat. Regeln sind: "Keine Schokolade vor dem Schlafengehen. Keine Zombie-Videos nach 20 Uhr. Händewaschen vor dem Essen." Ausnahmen beginnen mit: "Nur einmal, bitte, nur heute. Bei Oma darf ich das aber immer. Weil ich Geburtstag hab‘." Sofort wird klar, es gibt mehr Ausnahmen als Regeln. Klar ist aber auch: Man muss weder Logik noch Jura studieren, um zu wissen, was ein Regel-Ausnahme-Verhältnis ist.
Dass trotzdem die Juristen diese Technik geradezu gepachtet haben, zeigt sich sofort, wenn man das Wort einmal probeweise googelt. Eigentlich liegt es auf der Hand. Wer ständig Regeln aufstellt oder anwendet, hat eben auch dauernd mit Ausnahmen zu tun. Oft kann man die Regel sogar nur verstehen, wenn man die Ausnahme kennt. Oder es ist vor lauter Ausnahmen nicht mehr klar, ob nun die Regel überhaupt noch die Regel ist oder die Ausnahme.
Für Gesetzgeber und Vertragsgestalter ist das Arbeiten mit ihrer Lieblingstechnik auch unvermeidbar. Die Probleme sind meist komplex und/oder kompliziert, die Regelwerke müssen hingegen einigermaßen allgemein bleiben, damit sie noch verständlich sind und nicht zu umfangreich werden. Wie einfach oder schwierig nun der professionelle Umgang mit Normierungen und Sonderregelungen sein kann, zeigen ein paar ausgewählte Beispiele, die sich mitunter prima als Bewährungsprobe für ein Jurastudium eignen.
Ausnahmen bestätigen die Regel
Zu Anfang ist es noch recht einfach. Die Regel "Du sollst nicht töten" kannten die meisten Menschen schon vor dem Jurastudium. Im ersten Semester lernen sie dann fasziniert "Ausnahmsweise ist es erlaubt, andere Menschen zu töten, wenn man durch Notwehr gerechtfertigt ist." Auch im Krieg - eleganter: im Verteidigungsfall - darf man den Gegnern das Leben nehmen. Wenn das praktisch wird, dann oft gleich millionenfach. Und eigenartigerweise auf beiden Seiten, weil sich im Krieg ja jeder irgendwie verteidigt. Glückliche historische Umstände lassen aber diese Ausnahme zumindest in Nordwesteuropa ein wenig an den Rand des Bewusstseins rücken.
Bis hier ist es übersichtlich: Eine klare Regel, eine klare Ausnahme. Damit kann man leben. Aber natürlich geht es auch etwas komplizierter. Zum Beispiel, wenn die Norm einigermaßen knapp und verständlich formuliert ist, während die Besonderheit schon etwas umständlicher gerät.
§ 985 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) lautet: "Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen." Ein Satz, elf Wörter, inhaltlich nicht allzu schwierig. § 986 Abs. 1 S. 1 BGB heißt dann aber schon "Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist." Ein Hauptsatz, ein Nebensatz, ein Einschub, 29 Wörter, im Abstraktionsgrad schon ein wenig anspruchsvoller als die Regel. Und das ist immer noch halbwegs harmlos.
Kaufrecht: Rück-, Unter- und Gegenausnahmen
Um die einfache Frage zu beantworten, ob der Käufer einer Sache diese bezahlen muss, wenn er sie gar nicht erst erhält, weil sie auf dem Transportweg zerstört wurde, muss man zuerst nach einer Regel suchen. Die steht in § 433 Abs. 2 BGB: Wer eine Sache kauft, muss sie bezahlen. Das ist Alltagswissen und zivilrechtlicher Erstsemesterlernstoff.
Eine Ausnahme findet man in § 326 Abs. 1 BGB: Wer die gekaufte Sache unmöglichkeitsbedingt nicht erhält, muss sie nicht bezahlen. Das lernt man im zweiten Semester beim Allgemeinen Schuldrecht – und findet es noch überzeugend.
Damit sich aber jetzt kein Student beruhigt zurücklehnt, kommt gleich die Rückausnahme in § 447 Abs. 1 BGB hinterher: Wer die gekaufte Sache nicht erhält, weil sie unterwegs zerstört wurde, den Versand aber selbst veranlasst hat, muss sie trotzdem bezahlen. Mit ein wenig Gerechtigkeitsgespür ist das noch gut zu verstehen, zumindest wenn man weiß, dass normalerweise der Käufer die Sache beim Verkäufer abholen muss, § 269 Abs. 1 BGB. Technisch bedeutet diese Rückausnahme: Es gilt wieder die ursprüngliche Regel.
Für eine angemessene Erfassung der Probleme des wirklichen Lebens ist das aber noch nicht differenziert genug. Also führt der Gesetzgeber eine Unterausnahme ein, § 474 Abs. 2 BGB: Nicht bezahlen muss die nicht erhaltene Sache, wer zwar den Versand verlangt hat, aber als Verbraucher bei einem Unternehmer eine bewegliche Sache gekauft hat. Erst mit dieser Unterausnahme kann man einem Nichtjuristen erklären, ob er das beim Versandhändler bestellte Mobiltelefon nun bezahlen muss, obwohl er es nicht bekommt. Das ist immerhin schon gedankliche Akrobatik in einem vierstufigen Schema.
Damit es nicht zu einfach wird, gilt übrigens: Abweichende Vereinbarungen sind zulässig, zumindest in Individualvereinbarungen, § 475 Abs. 1 BGB. Das aber ist, wie so oft, umstritten.
Roland Schimmel, Juristenlogik : . In: Legal Tribune Online, 13.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14341 (abgerufen am: 27.07.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag