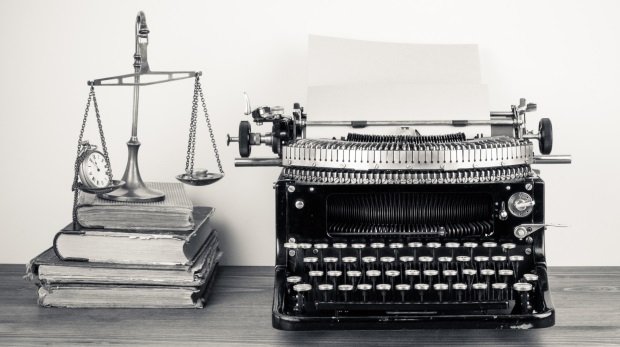Das BMJV schlägt eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen des Urhebervertragsrechts vor, um die Verhandlungsmacht der Urheber gegenüber den Verwertern ihrer Werke weiter zu stärken. Martin Soppe hat sich den Referentenentwurf angesehen.
Herta Däubler-Gmelin war in ihrer Zeit als Bundesjustizministerin für Urheber ein Quell der Freude: 2002 setzte sie gegen erheblichen politischen Widerstand das sogenannte Stärkungsgesetz durch. Das "Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern", so der offizielle Titel, sollte "Vertragsparität" zwischen Urhebern und den Verwertern schaffen. Das Ziel: eine angemessene Vergütung der Urheber für die Nutzung ihrer Texte, Fotos, Filme, Kompositionen und anderer Werke.
Jetzt sieht der amtierende Bundesjustizminister Maas erneut Regulierungsbedarf: Die seinerzeitigen Erwartungen des Gesetzgebers hätten sich "jedenfalls teilweise" nicht erfüllt, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Referentenentwurf. Er trägt den programmatischen Titel "Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung". Nach wie vor, so heißt es darin, seien die Urheber in vielen Branchen nicht in der Lage, angemessene Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke durchzusetzen. Wegen der "gestörten Vertragsparität" müssten sich Kreative immer noch in vielen Fällen auf Verträge mit unangemessenen Einmalzahlungen (Total Buy-outs) einlassen. Zudem hätten sie oft nicht die Markt- und Verhandlungsmacht zur Durchsetzung ihrer Ansprüche: Versuchten sie dies, drohe ihnen "häufig ein faktischer Boykott ('Blacklisting')".
Vertragsparität durch doppelte Stärkung
Zum einen soll die individualrechtliche Stellung der Urheber gestärkt werden: Bei mehrfacher Nutzung ihrer Werke sollen sie regelmäßig an allen hieraus resultierenden Erlösen zu beteiligen sein. Zudem sollen sie die Möglichkeit erhalten, nach Ablauf von fünf Jahren Rechte vom jeweiligen Verwerter zurückzurufen, wenn sich ein anderer Vertragspartner zur Verwertung nach dem Rückruf verpflichtet hat. Der bisherige Verwerter wird dem Entwurf nach nur die Möglichkeit haben, durch die Ausübung einer Art Vorkaufsrecht zu den neuen Konditionen den Vertrag mit dem Kreativen zu verlängern.
Zusätzlich soll der Urheber einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über die Nutzung seiner Werke haben – mindestens einmal jährlich muss der Verwerter demnach berichten. Abgesichert werden soll all dies durch Regelungen, nach denen abweichende Vereinbarungen ausschließlich zugunsten der Urheber oder durch gemeinsame Vergütungsregeln zulässig sind.
Zum anderen stärkt der Entwurf die Position der Urheber auch prozedural durch ein Verbandsklagerecht. Urheberverbände können danach Individualverträge am Maßstab gemeinsamer Vergütungsregeln überprüfen lassen und Unterlassungsansprüche durchsetzen. Zudem soll die Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln erleichtert werden.
Unterschiedliche Reaktionen
Der Journalistenverband und die Gewerkschaft begrüßen die Reform grundsätzlich. Ver.di sieht in dem Entwurf "einen dringend notwendigen und lange überfälligen Schritt zur Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen der professionellen Medien- und Kulturschaffenden in Deutschland." Allerdings gebe es "Punkte, an denen nachgebessert werden sollte."
Demgegenüber reagierte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit scharfer Kritik und forderte "Sachpolitik statt Interessenpolitik". Die Verbände der Zeitungs- und der Zeitschriftenverleger, BDZV und VDZ, meinen, das Justizministerium handle "kurzsichtig". Unter anderem werde mit der Ausweitung der Auskunftsansprüche eine "enorme Bürokratie aufgebaut". Die Produzentenallianz sieht in dem "missglückten Entwurf" gar "eine dramatische Verschärfung des Eingriffs in die Vertragsfreiheit".
Referentenentwurf zum Urhebervertragsrecht: . In: Legal Tribune Online, 16.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17230 (abgerufen am: 27.07.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag