Dieses Mal beschäftigten Sie u.a. das Staatsexamen am Computer, die Umbenennung des Palandt und die deutschen Rüstungsexporte. Aber auch die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche hat für Diskussionen gesorgt.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl von Leserbriefen, die uns in den vergangenen Tagen erreicht haben. Die Auswahl ist nicht repräsentativ für das Leserecho, das Sie weiterhin auch bei Facebook sowie Twitter finden. Wir nehmen ausdrücklich auch kritische Reaktion auf, konnten aber auch in dieser Woche vieles nicht berücksichtigen. Viele Zuschriften sind nicht rechtlicher Natur und/oder tragen nichts zur fachlichen Debatte bei. Einige Post konnten wir auch nicht veröffentlichen, weil Sie uns nicht mit Klarnamen geschrieben haben - schade. Unsere Leserbrief-Richtlinien finden Sie hier.
Hamburg will Examensklausuren am Computer: Kommt das Staatsexamen 2.0 - jetzt endlich?
 Was in anderen Fächern schon Realität ist, soll auch bei den Juristen Einzug halten: digitale Prüfungen. Nun haben SPD und Grüne in Hamburg einen neuen Vorstoß gewagt. Kommt bald das Examen am Computer?
Was in anderen Fächern schon Realität ist, soll auch bei den Juristen Einzug halten: digitale Prüfungen. Nun haben SPD und Grüne in Hamburg einen neuen Vorstoß gewagt. Kommt bald das Examen am Computer?
Von Philipp Takjas, LL.M. (UCLA)
Bereits 2009 war es an law schools in den USA absolut gängig, Klausuren auf Laptops zu schreiben. Es gibt spezielle Software, beispielsweise ExamSoft, die alle anderen Applikationen während der Klausur blockiert. Auch die Anwaltszulassungsprüfungen (bar exam) können seit vielen Jahren auf Laptops geschrieben werden. Und die Hardware bringt jeder selbst mit.
Natürlich ist keine Software fehlerfrei und es gab schon Skandälchen um "betrunkene" Examenssoftware (beispielsweise beim Bar Exam in Kalifornien). Aber 100 %-ige Sicherheit gibt es nun einmal nicht – es gibt bekanntlich auch Richter, die vorab Klausuren verkaufen…
Die Studenten werden nicht gezwungen, Laptops zu nutzen. Eine Professorin regte sogar ausdrücklich an, per Hand zu schreiben unter Hinweis darauf, dass handgeschriebene Klausuren im Schnitt besser seien. Es sei zwar bequemer für die Korrekturen, getippte Essays zu prüfen, aber im Ergebnis mache es mehr Freude, einen guten Essay zu lesen. Auch Studien bestätigen, dass handgeschriebene Prüfungen besser ausfallen. Dennoch sollte es den Prüflingen selbst überlassen werden.
Ich schrieb alle Klausuren per Hand und fuhr gut damit. Aber im Jahr 2018 gezwungen zu sein, 40 Stunden per Hand zu schreiben, ist doch sehr antiquiert.
Von Lasse Gielsdorf, Student an der Bucerius Law School und Vorsitzender der Juso HSG dort, der einen Antrag zur Digitalisierung des juristischen Staatsexamens in Hamburg verfasst hat
Es ist mittlerweile schon einige Jahrzehnte her, dass die Digitalisierung Einzug in unser Leben genommen hat. Solange, dass sich auch die Jurisprudenz, mithin wohl eine der konservativeren Geisteswissenschaften, sich ihrer nicht länger verwehren kann.
E-learning, Legal Tech und andere digitale Innovationen sind dabei, die juristische Arbeitsweise nachhaltig zu verändern. Daneben gehört es mittlerweile jetzt schon zum Alltag, dass juristische Schriftsätze (seien sie akademischer oder praktischer Natur) am Computer verfasst werden. Undenkbar ist die Vorstellung, dass Jurist*innen von heute wertvolle Arbeitszeit damit verschwenden, mühselig an der Schreibmaschine zu tippen oder gar ihre Texte handschriftlich zu verfassen. Und doch scheint hier in Bezug auf die Ausbildung von Jurist*innen die Zeit stehen geblieben zu sein.
Trotz mehrfacher Grundsatzdiskussionen über das Thema gibt es für Jurastudierende auch heute immer noch keine Alternative dazu, ihre Klausuren nicht in handschriftlicher Form abzuleisten, obwohl wichtige Gründe dafür sprächen, dies endlich zu ändern.
Ein erster Grund findet sich in der schon lange digital gestalteten Arbeitswelt von Jurist*innen. Die universitäre Ausbildung dient nicht zuletzt dazu, Studierende optimal auf ein späteres Arbeitsleben vorzubereiten. Ein Arbeitsleben, das voraussetzt, dass Jurist*innen Texte sicher und schnell an der Tastatur verfassen. Während Studierende also über Jahre darauf getrimmt werden, lesbar und gleichzeitig schnell per Hand schreiben zu können und dafür mit besseren Noten belohnt werden, wird diese Fähigkeit nach dem Studium nutzlos, wenn es darauf ankommt, im Zehnfingersystem Schriftsätze am Computer zu schreiben. Es erscheint sinnvoller, Studierende von Anfang an konsequent im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen zu trainieren und ihre Fähigkeiten dahingehend zu stärken, um die Realität nach der Ausbildung schon im Studium abzubilden.
Ferner hat man sich den Anspruch gestellt, Prüfungsleistungen im Jurastudium so objektiv zu bewerten wie irgend möglich. Anstelle von Namen auf den Klausurheften greift man auf Prüfungsnummern zurück, um zu gewährleisten, dass die Identität des Prüflings keinen Einfluss auf die Bewertung der Leistung nimmt. Grundsätzlich ein löblicher Ansatz, der jedoch noch weit hinter seinem Anspruch zurückbleibt, da gerade die Handschrift unterbewusst mehr über den*die Träger*in aussagt und ihren Leser*innen vermittelt als manch ein*e Korrektor*in sich vermutlich in seiner Korrektur kritisch bewusstmacht.
Wer hat nicht Szenen seiner Schulzeit im Kopf, in denen besonders ordentlich schreibende männliche Schüler wegen ihrer "Mädchenschrift" gelobt wurden? Wer kennt nicht das Vorurteil der chaotischen Arzthandschrift? Klar ist, alleine durch die traditionell gesellschaftliche Wertung, fällt es schwer auszuschließen, dass der*die Leser*in nicht für sich eine Verbindung herzuleiten versucht zwischen Schriftbild und seinem*r Träger*in.
Für die Anfertigung von Klausurleistungen heißt das, dass sofern wir den Grundsatz ernst nehmen, dass die Identität und dabei insbesondere das Geschlecht des Prüflings keine Rolle für die Korrektur der Klausur spielen soll, wir langfristig eine Abkehr von der Handschrift anstreben müssen.
Klar sollte sein, dass sich diese Entwicklung nicht von heute auf morgen vollziehen lässt. Dieser Umstand kann jedoch nicht als Entschuldigung begriffen werden, sich nicht offensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen.
In der Vergangenheit wurden oft zahlreiche Vorwände konstruiert, um einer Umsetzung aus dem Weg zu gehen. Demnach wäre die Schaffung der nötigen Infrastruktur von vorneherein zu komplex, die Wahrung der Handschrift als elementares Kulturgut zu wichtig und sowieso haben wir das doch schon immer so gemacht! Dadurch sollten wir uns aber nicht leiten lassen.
Gelegentlich neigen wir dazu, das Selbstbild des konservativen Juristen vor uns herzuschieben. Nicht immer geschieht das jedoch auch aus Überzeugung. Sondern oftmals vielmehr aus Bequemlichkeit. Dem gegenüber steht für mich ein anderer Wert: "Mutig sein!"
SPD-Fraktion plant Beschluss zur Umbenennung: Palandt-Diskussion im Rechtsausschuss?
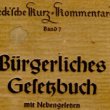 Wie mit dem nationalsozialistischen Erbe des Palandt umzugehen ist, wird schon seit längerer Zeit diskutiert. Die SPD-Bundestagsfraktion will daraus jetzt auch einen Fall für den Rechtsausschuss machen.
Wie mit dem nationalsozialistischen Erbe des Palandt umzugehen ist, wird schon seit längerer Zeit diskutiert. Die SPD-Bundestagsfraktion will daraus jetzt auch einen Fall für den Rechtsausschuss machen.
Von Friedrich Engelke, Rechtsanwalt
Sie haben sich mit der Thematik der Umbenennung des "Palandt" beschäftigt. Vorab bemerke ich dazu, daß die Tätigkeit dieses Kronjuristen der NS–Bewegung sicherlich schon an anderer Stelle ihre Würdigung gefunden hat (siehe u.a. Gruchmann, Justiz im Dritten Reich, 2. Aufl., München 1990, S. 303 f.), insbesondere in Hinblick auf die von ihm betriebene körperliche und geistige Ertüchtigung der damaligen Rechtsreferendare. Auch werden wir gewiß keine Differenzen in der Auffassung über die geschichtliche Einordnung der NS–Zeit haben und ebenfalls nicht auf den Gedanken kommen, diese schlimmste Periode der Deutschen Geschichte als "Fliegenschiß" (Gauland) anzusehen. Gleichwohl habe ich Bedenken, ob die derzeitigen Aktivitäten, "den" Palandt umbenennen, bzw. ihm seinen Namen nehmen zu wollen, als eine übertriebene Adaption an den Zeitgeist angesehen werden muß.
1.) Natürlich habe ich die Stellungnahme des Verlages Beck zu dieser Thematik in der aktuellen Ausgabe gelesen. Sie ist kurz und treffend, ich halte sie für richtig.
2.) Wenn wir heute den Palandt benutzen, so tun wir das ganz gewiß nicht unter dem Aspekt, dem alten Nazi–Anhänger irgendeine Referenz erweisen zu wollen, sondern gerade das Gegenteil ist der Fall. Diese Kommentierung repräsentiert den heutigen Stand liberaler Rechtsprechung und Literatur zu ganz wesentlichen Teilen unseres Rechtes. Wenn Herr Palandt den Inhalt dieses, "seines" Kommentares heute zur Kenntnis nehmen könnte, würde er sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn es denn beim einfachen Umdrehen bliebe, wahrscheinlich hätte man es eher mit Rotationen zu tun. Der Name des Kommentars steht für etwas ganz anderes, als wir das von Herrn Palandt kennen, er steht für einen modernen Rechtsstaat, an dem es nach wir vor sicherlich einiges zu verbessern oder zu verändern gilt, wobei die Vorstellungen über mögliche Änderungen gewiß auch von den individuellen politischen Positionen abhängen.
3.) Dieser Kommentar hat nichts mehr zu tun mit der Kommentierung aus der NS–Zeit. Wenn wir uns beispielsweise die Vorworte der 1. Auflage (Palandt, Dr. Otto [Hrsg.], Friesicke u.a., München, 1938, vollständiger Neudruck als 2. Aufl., 1939) und des Nachdruckes anschauen, wissen wir natürlich, welcher Geist dahintersteckt (Beispiel: 2. Aufl., Vorwort Bl. V), wenn von der gewonnen Vormachtstellung des Deutschen Reiches die Rede ist. Interessant ist auch die Darstellung der Eheverbote lt. EheG vom 6. Juli 1938, die sich mit einer Eheschließung "der völkischen Ordnung zuwider" (a.a.O., 2. Aufl., Einf. vor EheG 4, "Eheverbote") und der Nichtigkeit solcher Eheschließungen lt. BlSchG § 1 ("Blutschandegesetz") beschäftigen. Diese Dinge sind – glücklicherweise – alle passé, kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee, so etwas Ernst zu nehmen.
Ich sehe die jetzigen Aktivitäten als ein Hinterherhecheln hinter dem Zeitgeist an. Wenn wir das Gedankengut, das hinter den Namensänderungsverlangen steht, ernsthaft umsetzen wollten, müssten wir einen erheblichen Teil der Hamburger Straßennamen ändern. Denken Sie nur an die Methfesselstraße – was hat der für blutrünstige Liedertexte verfasst, das Kaiser–Wilhelm–Denkmal, das inzwischen ganz verschämt am Sievekingplatz zur Seite gerückt wurde: Der Kartätschenprinz von 1848, der die damaligen Aufständischen niederschießen ließ, die Bismarcksäule am Hafen dürfte der Sprengung anheimfallen – Verzeihung, ich habe mich vertan, das wäre ja umweltschädlich, man müßte sie wohl à la Christo verhüllen! Man bedenke nur, wie Fürst Otto von Bismarck politisch gearbeitet hat, die provozierende Emser Depesche ….. die Liste ließe sich beliebig verlängern. Man müßte dann auch weitere Denkmäler ins Auge fassen, beispielsweise den Marx–Kopf ("Nischel") in Chemnitz. Wir hätten plötzlich sehr viel zu tun.
Wenn der heutige "Palandt", den ich als eine Marke im untechnischen Sinne ansehe, von seinen Verfassern und / oder dem Verlag in irgendeiner Weise nach dem Kriege zum Transport einer den Nazis nachtrauernden ideologischen Rechtsposition verwendet worden wäre, hätte er sich nicht derartig entwickelt, im Gegenteil, wir hätten es alle zu Recht abgelehnt, ein solches Machwerk in der täglichen Arbeit zu verwenden.
LG Gießen zur Werbung für Schwangerschaftsabbruch: Berufung von Ärztin Hänel abgewiesen
 Die Ärtzin Kristina Hänel bleibt auch in zweiter Instanz erfolglos. Ihre Berufung gegen das Urteil der Erstinstanz, die wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verhängte, wies das LG Gießen ab.
Die Ärtzin Kristina Hänel bleibt auch in zweiter Instanz erfolglos. Ihre Berufung gegen das Urteil der Erstinstanz, die wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verhängte, wies das LG Gießen ab.
Von Dr. Wolfgang Vorhoff, Gynäkologe
Ich bin niedergelassener Frauenarzt in Bayern, kein Abtreibungsgegner, obwohl ich selbst keine Abtreibungen mehr durchführen kann. Ich habe das früher gemacht, bis irgendwann der Punkt kann, wo ich das nicht mehr konnte. Die Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht dafür aufgestellt hat, sind, aufmerksam gelesen und ohne ideologische Brille, richtig. Auch dass der Schwangerschaftsabbruch im Abschnitt 16 des StGB steht – Taten gegen das Leben –, ist richtig. Denn der Schwangerschaftsabbruch beendet ein Leben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es wird ein Leben vor der Geburt beendet.
In Deutschland gibt es einen sehr ausgewogenen Kompromiss zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und dem der ungewollt Schwangeren.
Wer in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch machen muss (oder will), dem wird es nicht schwer gemacht. Es sind nur ein paar wirklich einfache Spielregeln zu beachten. Schwangerschaft von einem Arzt feststellen und Schwangerschaftsalter bestimmen und schriftlich oder mit Ultraschallbild bestätigen lassen. Danach zur Beratungsstelle. Da kann man die Ohren auf Durchzug stellen oder zuhören. In jedem Fall erhält man dort den Beratungsschein. Mit dem kann drei Tage später der Abbruch von einem Arzt durchgeführt werden. Ohne Wenn und Aber geht das in den 12 Wochen nach der Empfängnis, also 14 Wochen nach der letzten Regel.
In der derzeitigen Diskussion um den §219a 8Strafgesetzbuch, Anm. d. Red.] wird ständig behauptet, dass Frauen sich wegen des §219a nicht richtig informieren könnten. Und dass Ärzte, die einfach nur objektiv informieren, kriminalisiert würden. Das stimmt natürlich nicht. Der Gesetzgeber will einfach nicht, dass derjenige "informiert", welcher dann beim Abbruch auch ein finanzielles Eigeninteresse durch Anbieten und Ausführen der "Dienstleistung" hat. Gesetzesbegründung 1974: "Sie will verhindern, daß der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird.“
Was mich in der derzeitigen Diskussion um den §219a wirklich besorgt macht um unsere Demokratie, ist die Tatsache, wie hier glatter Unsinn vom gesamten Mainstream der Berichterstattung als Wahrheit übernommen und instrumentalisiert wird. Alle glauben das Märchen und laufen in dieselbe Richtung.
Wirklich kein Mensch benötigt Werbung für die Abtreibung oder Werbung von Abtreibungskliniken, wie sie in anderen Ländern gang und gäbe sind. [Beispiel von der Redaktion entfernt]
In vielen Artikeln zum Thema wird beklagt, dass "Die Debatte tobt, seit eine Ärztin dafür verurteilt wurde, auf ihrer Webseite über Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis informiert zu haben.“
Schauen Sie sich mal die Webseite der mittlerweile als Ikone der Frauenbewegung mehrfach ausgezeichneten Ärztin Kristina Hänel an. Das ist da keine reine, selbstlose Information für Frauen in Notlage, die sonst überhaupt nicht wüssten, wohin sie sich zu wenden haben, wenn sie einen Abbruch machen.
Da steht klar "Ich biete an", "in unserer Praxis" und der (kostenpflichtige) Schwangerschaftsabbruch ("Was müssen Sie mitbringen: …Bargeld…") steht direkt neben der IGEL-Leistung Blutegeltherapie und Reitherapie. Tut mir leid, das ist Werbung. Aber die Werbebranche nennt ihre Maßnahmen ja auch Informationskampagnen, nicht wahr?
Nach meinem Dafürhalten ist die Homepage eines Dachdeckers, Steuerberaters, Architekten oder eines Arztes immer ein Werbeinstrument. Meine ist das auch. Ich "informiere" die Öffentlichkeit, was ich anbiete. Ich würde damit auch für Schwangerschaftsabbrüche werben, wenn ich dort schriebe: Leistungsspektrum Schwangerschaftsabbrüche. Das ist allen klar, die das machen. Leute wie Kristina Hänel oder N. S. [Name von der Redaktion abgekürzt] wissen das auch. Sie geben es nur nicht zu.
Und es ist schlicht nicht wahr, wenn stereotyp nunmehr in allen Medien behauptet wird, wegen des §219a könnten die Ärzte nicht sachgerecht und objektiv über Schwangerschaftsabbrüche informieren und die Schwangeren wüssten deshalb nicht, wo sie den Abbruch machen lassen können. Das ist kompletter Unsinn. Jede schwangere Frau geht mit positivem Schwangerschaftstest umgehend zum Frauenarzt und die im Schwangerschaftskonflikt erst recht (die bekommen übrigens auch ohne Terminservicestelle schnelle Termine!). Dort wird (und muss!) sie nach der "Richtlinie zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch" umfassend beraten werden. Keine Patientin mit Schwangerschaftskonflikt verlässt meine Praxis ohne die Adressen der Beratungsstellen und die Adresse der Ärzte, von deren Behandlungsqualität beim Abbruch ich mich überzeugt habe. Dann gehen die zur (Zwangs-)beratung und auch dort wird den Schwangeren im Bedarfsfall mitgeteilt, wo der Abbruch gemacht werden kann. Wenn sie sich nicht doch in nicht allzu wenigen Fällen nach der Beratung zum Austragen der Schwangerschaft entscheiden. Die Beratungsstellen machen nämlich wirklich Sinn. So wird aus mancher zunächst ausweg- und alternativlos erscheinenden Lage doch noch eine glückliche Zukunft mit Kind. (Ich betreue die Frauen dann ja in der Schwangerschaft und danach und das ist kein "Lebensschützergerede" oder paternalistischer Unsinn.)
Was allerdings auch richtig ist: Durch Werbung mit dem Schwangerschaftsabbruch wird keine Abtreibung gefördert oder durch Nicht-Werbung verhindert. Aber vielleicht wird sie durch die "Information" auf der Homepage dessen, der das veröffentlicht, dorthin gelenkt, während die Ärzte, die korrekt den Weg über die Beratungsstellen oder die Information anderer Ärzte gehen, "leer" ausgehen. Eine Abschaffung des Werbeverbotes wird zu einem Wettbewerb um die beste Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch führen. Die Modifizierung des Werbeverbotes wird zu einem Wettbewerb um die beste, rechtlich grade noch zulässige Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch führen.
In manchen Ländern ist das Vorgehen seitens der Regierung etwas seltsam, so auch hier in Bayern. Die Beratungsstellen erhalten hier keine Listen von Abtreibungsärzten. Diese von der Bezirksregierung angelegten Listen sind im Gesundheitsamt hinterlegt, wo die Schwangeren sie einsehen (nicht kopieren!) dürfen(*). Aber glauben Sie mir: Auch ohne offizielle Listen lassen die Beratungsstellen keine Frau "im Regen stehen". Die guten Beratungsstellen sind nicht blöde, die beschaffen sich die Information anders. Die haben sich ja damals bei Einführung der staatlichen Beratungsstellen ordentlich mit dem Papst angelegt und haben auch so genug Selbstbewusstsein für die Diskussion mit der Staatsregierung.
[Hinweis von der Redaktion entfernt]
Also bitte: Nicht schreiben, dass wegen des §219a Schwangere von Informationen abgeschnitten sind. Sie bekommen die Information. Neutral und nicht von Eigeninteresse geleitet.
Rüstungsexporte nach Tod des Journalisten Jamal Kashoggi: Beißhemmung der Politik
 Nach der Ermordung Jamal Kashoggis flammt die Diskussion um Rüstungsexporte nach Saudi Arabien erneut auf. Die Politik muss entscheiden, wie sich das Rüstungsexportrecht weiterentwickeln soll, meint Sebastian Roßner.
Nach der Ermordung Jamal Kashoggis flammt die Diskussion um Rüstungsexporte nach Saudi Arabien erneut auf. Die Politik muss entscheiden, wie sich das Rüstungsexportrecht weiterentwickeln soll, meint Sebastian Roßner.
Von Dr. Robert Glawe, Rechtsanwalt
Die Legal Tribune Online schätze ich als ein Portal für Information und Meinungseindrücke, das mit juristischer Expertise unterfüttert ist. Daher habe ich mich auch gerne mit eigenen Beiträgen beteiligt. Beiträge wie der oben zitierte von Herrn Roßner tragen jedoch dazu bei, zumindest den Eindruck juristischer Expertise bei LTO zu erschüttern, wenn nicht sogar Ihre Unparteilichkeit in Frage zu stellen.
Ich beschäftige mich intensiv mit dem Recht der Exportkontrolle und weiß, wie schwierig es ist, sich dieses Gebiet zu erschließen und überdies die sensiblen politischen Anwendungsfälle unter diese komplexe Struktur von Grundgesetznormen bis zu europäischen Verordnungen und Verwaltungsinnenrecht zu subsumieren. Auch ist mir Ihre Unterteilung der Beiträge in reine Sachinformation und durchaus pointierte Kommentierung bewusst. Selbst wenn man den Beitrag von Herrn Roßner eindeutig letzterem zuordnet, bleibt der Beigeschmack eines tendenziösen Beitrags, der ausschließlich eine bestimmte, seit Jahren erhobene Klientelforderung bedient. Dazu werden Sachinformationen z.B. zur Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes derart verkürzt, bis der Eindruck entsteht, es gebe auf diesem Feld kein gesetzliches Korrektiv; eine "noch festzulegende Gruppe anerkannter Friedensorganisationen" müsse daher anstelle von Behörden und Gerichten für die Wahrung rechtsstaatlicher Standards sorgen. Das ist ungeheuerlich und führt gerade dem unbedarften Leser, der diese Materie noch nicht durchdrungen hat, ein vollkommen verzerrtes Bild der Exportkontrolle vor. Tatsächlich finden wir in diesem Bereich eine staatliche Regulierung wie nirgends sonst.
Dieser Beitrag bedient in seiner Mischung aus inhaltlich-sachlichen Fehlern, Unterschlagung für die Debatte wesentlicher Fakten zum Rechtssystem und Rechtsschutz und undifferenzierter Propagierung einer Forderung, die nicht ohne Grund kaum öffentlich Gehör findet (Absehen von der Zulässigkeitsvoraussetzung der Verletzung subjektiver Rechte im Verwaltungsstreitverfahren), all das, was ich sonst nur aus den qualitativ minderwertigen Online-Portalen von Focus/Welt/SpOn/Bento/Jakob Augstein etc. kenne: Stimmungsmache mit (scheinbar) populären Forderungen auf Basis dünner, fehlerhafter Sachinformation. Bitte stellen Sie sich in Ihrer Redaktion die Frage, ob Sie zu diesen "Konditionen" in ein juristisches Boulevardformat einsteigen möchten. Zumindest mich würden Sie dann als Autor und Leser verlieren.
Leserbriefe an LTO: Zum Staatsexamen 2.0, zur Palandt-Umbennung und zu Rüstungsexporten . In: Legal Tribune Online, 02.11.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31845/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag





