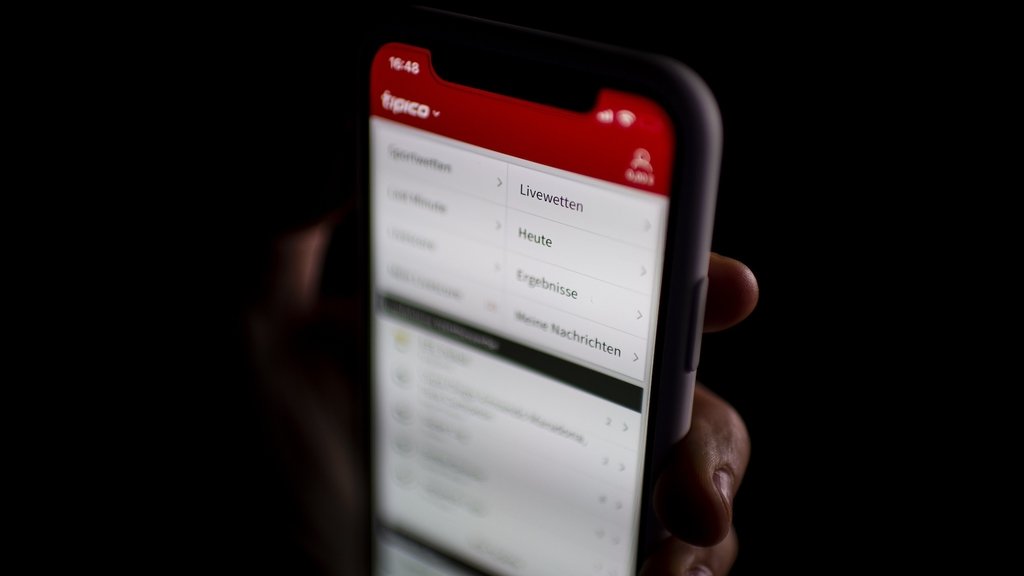Ein Urteil des BGH begrenzt die Gesellschafterfähigkeit für eine Anwalts-GmbH auf natürliche Personen und BGB-Gesellschaften. Diese Rechtsauffassung ist nicht mehr zeitgemäß, meint Volker Römermann.
Anwälte dürfen eine GmbH gründen. Sie dürfen auch eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung gründen. Wenn aber die anwaltliche Partnerschaft die Geschäftsanteile der GmbH übernimmt, so wird der GmbH die Zulassung entzogen.
So geschehen in Baden-Württemberg bei einer mit über 80 Berufsträgern nicht ganz kleinen Partnerschaft. Die GmbH wehrte sich, verlor beim Anwaltsgerichtshof (AGH Stuttgart, Entscheidung v. 01.06.2016, Az. AGH 18/15 II) und nun auch beim Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs (BGH , Urt. v. 20.03.2017, Az. AnwZ (Brfg) 33/16).
BGB-Gesellschaft als Gesellschafterin anerkannt
Als das AnwaltsGmbH-Gesetz am 1. März 1999 in Kraft trat und damit auch § 59e Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), war noch nicht einmal sicher, ob überhaupt jemand anders als natürliche Personen Gesellschafter einer Anwalts-GmbH werden könnte. "Gesellschafter einer Rechtsanwaltsgesellschaft können nur Rechtsanwälte und Angehörige der in § 59a Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 genannten Berufe sein", so der Wortlaut des § 59e Abs. 1 Satz 1 BRAO.
Nach anfänglichem Zaudern erkannte die Literatur jedenfalls rasch an, dass gegen einen Zusammenschluss der Gesellschafter als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft) nichts spreche. Das fand für das Zusammengehen von Patentanwälten auch den Segen des BGH (Beschl. v. 09.07.2001, Az. PatAnwZ 1/00 – zur Parallelvorschrift des § 52e PAO).
In seinem Urteil vom 20. März 2017 schließt sich der Anwaltssenat dieser Einschätzung für das Recht der Rechtsanwälte ausdrücklich an. Damit war aber noch nichts darüber ausgesagt, ob auch eine Partnerschaft als Gesellschafterin der Anwalts-GmbH in Betracht käme.
Absicherung nach historischer Methode
Diese Frage wurde nun vom Anwaltssenat erstmals entschieden. Mit einem Nein: "Juristische Personen mit eigener, von den an ihnen beteiligten Berufsangehörigen vollständig losgelöster Rechtspersönlichkeit" seien nicht gesellschafterfähig, meint der Anwaltssenat. Das gelte dementsprechend auch für Personengesellschaften, wie die Partnerschaftsgesellschaft, die einer juristischen Person weitgehend angenähert seien.
Die Rechtsanwaltsgesellschaft sei eine Berufsausübungsgesellschaft, die aus natürlichen Personen bestehe, so der Senat. Dieser Wille des Gesetzgebers gehe eindeutig aus den Gesetzesmaterialien hervor. Die Anwälte seien unabhängige Organe der Rechtspflege, und das persönliche Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber unverzichtbar. Die Gesellschaft müsse eine möglichst transparente Struktur aufweisen und hierdurch vor Abhängigkeiten und Einflussnahmen geschützt werden.
Erstaunlich zunächst, dass der Anwaltssenat nun lange Textpassagen aus den Gesetzesmaterialien zitiert, um sich nach der historischen Methode abzusichern und die Konformität mit dem historischen Gesetzgeberwillen zu demonstrieren. Derselbe historische Gesetzgeber hatte nämlich auch die BGB-Gesellschaft als potenzielle Gesellschafterin verworfen (Begr. des Regierungsentwurfs, BR-Drs. 13/9820, 14), die doch der Anwaltssenat nun explizit für zulässig erklärt.
Partnerschaft weniger vertrauenserweckend?
Aber auch mit den anderen Argumenten ist es schon auf den zweiten Blick nicht weit her: Wieso sollte das Vertrauensverhältnis des Mandanten zur Anwalts-GmbH – nur mit ihr schließt er seinen Mandatsvertrag – dadurch berührt werden, ob Gesellschafterin dieser GmbH nun eine GbR oder eine Partnerschaft ist?
Möchte der Anwaltssenat des BGH in diesem Zusammenhang tatsächlich zum Ausdruck bringen, dass eine Partnerschaft die gegenüber einer GbR weniger vertrauenserweckende, weniger transparente, die Interessen der Rechtspflege in Gefahren stürzende Rechtsform sei? Dabei verfügt doch die Partnerschaft – anders als eine GbR – gerade über ein öffentliches Register, in dem auch die Namen und Berufe sämtlicher Gesellschafter für jedermann abrufbar verzeichnet sein müssen.
Transparenter geht es kaum und doch schon gar nicht durch eine GbR, die nirgends registriert ist und deren Gesellschafter für das Publikum nicht erkennbar sind – einmal abgesehen von der historischen Primärquelle anwaltlicher Briefbögen.
2/2: Schwer durchdringliches Normengeflecht
Natürlich führt der BGH zur Begründung seiner Entscheidung auch die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte ins Feld. Sie gehört neben der Rechtspflege und dem Organ derselben zum Standard-Repertoire berufsrechtlicher Sentenzen. Dabei erschließt sich dem kritischen Leser oft nicht, was das alles konkret mit dem jeweiligen Sachverhalt zu tun haben könnte.
In einer GmbH besteht eine gewisse Abhängigkeit der Mitarbeiter, auch der anwaltlichen, von den Geschäftsführern, denn Letztere dürfen Weisungen erteilen. Die Geschäftsführer wiederum sind aus Sicht des Gesellschaftsrechts nach§ 46 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) den Weisungen der Gesellschafterversammlung unterworfen. Aus Sicht des Berufsrechts soll das nach § 59f Abs. 4 BRAO indes nicht gelten. Die Normen stehen in einem sonderbaren, aus Sicht des Gesellschaftsrechts schwer auflösbaren Widerstreit.
Der BGH nennt nun noch eine weitere Facette in diesem ohnehin schwer durchdringlichen Normengeflecht: Die Abhängigkeit von Weisungen einer BGB-Gesellschaft als Gesellschafterin ist offenbar in Ordnung, die Abhängigkeit von einer Partnerschaft als Gesellschafterin der Anwalts-GmbH ginge hingegen zu weit. Warum nun könnte die eine Rechtsform die – berufsrechtlich betrachtet relative – Abhängigkeit gegenüber der anderen Rechtsform erleichtern oder bis zur Unzulässigkeit verstärken?
Leitbild anwaltlicher Berufsausübung
Sog. "mehrstöckige Gesellschaften" habe der Gesetzgeber ausdrücklich abgelehnt, referiert der BGH zutreffend. Das war noch der Gesetzgeber, der die BGB-Gesellschaft als Leitbild anwaltlicher Berufsausübung vor Augen hatte. Neue Rechtsformen waren ihm suspekt, die Partnerschaft eigentlich ein Ablenkungsmanöver zur Vermeidung der ungeliebten GmbH.
Dann, als die GmbH von der Rechtsprechung anerkannt und damit unausweichlich geworden war, wurde sie normiert, aber wie? Mit dem Ziel, die unvermeidliche Rechtsform möglichst unattraktiv auszugestalten. Spät erst hat sich der Gesetzgeber schrittweise an die Vorstellung gewöhnt, dass anwaltliche Unternehmen eine Haftungsbeschränkung für sich in Anspruch nehmen können sollen und dass das ethisch auch nicht verwerflich ist.
Dieses Leitbild also, jüngeren Berufskollegen muss es sich anfühlen wie aus fernen Tagen, dieses Leitbild begründet nun die Ablehnung jeglicher Strukturen, bei denen Gesellschaften sich an Gesellschaften beteiligen – mit der einzigen, dann im Grunde unerklärlichen Ausnahme der BGB-Gesellschaft. Dabei ist doch zu fragen, was daran so schlimm wäre, wenn eine, z.B. ausschließlich aus sozietätsfähigen Berufen bestehende Gesellschaft sich an einer anderen Rechtsform beteiligen würde, die nach außen die Mandatsverträge schließt.
Doch dieses Konstrukt, ein möglicher "Anwaltskonzern", ist offenbar ein Schreckensbild. Es zerfällt jedoch - auf die simple Frage des "Warum eigentlich nicht?" - vor den eigenen Augen zu Staub. In ein paar Jahren jedoch wird sich das anwaltliche Gesellschaftsrecht dem Recht der anderen Unternehmen weiter angeglichen haben. Die Anwalts-GmbH & Co. KG ist dann eine selbstverständliche Rechtsform und über Verbote von Beteiligungen der Gesellschaften untereinander spricht niemand mehr. Der Anwaltssenat hat die Entwicklung auf diesem Weg noch einmal leicht verzögert, aufhalten wird er sie nicht können.
Prof. Dr. Volker Römermann ist Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG, Hamburg/Hannover/Berlin. Zu seinen Schwerpunkten in der Beratung sowie in der Lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin gehören das anwaltliche Berufsrecht und das Gesellschaftsrecht.
Prof. Dr. Volker Römermann, BGH zur Gesellschafterfähigkeit bei Kanzleien: Unverständliche Restriktionen bei Anwalts-GmbH . In: Legal Tribune Online, 02.05.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22792/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag