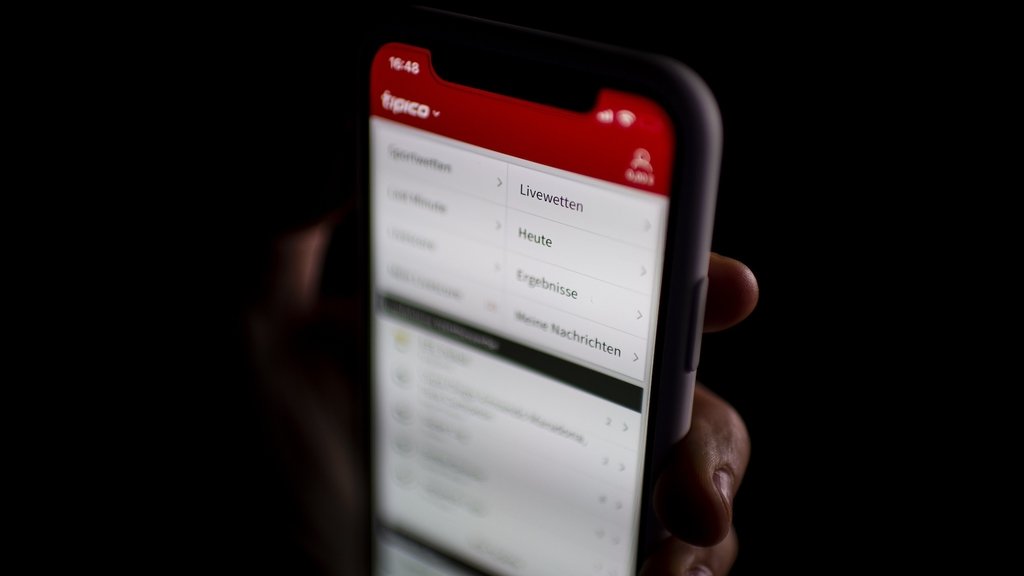Obwohl das Strafbefehlsverfahren eine Ausnahme sein soll, ist es längst das beliebteste Mittel der Justiz, weil es Ressourcen spart. Doch etwas gerät dabei zusehends in Vergessenheit: der Grundsatz der Mündlichkeit. Von Alexander Rupflin.
Es ist Sonntag, 16. November 1980. Professor Louis Althusser erwacht am Morgen in seiner Wohnung in Paris. Neben ihm liegt seine Frau Héléne auf dem Rücken. Noch im Halbschlaf beugt er sich über sie, um ihr den Nacken zu massieren, wie er das oft getan hat. Auch fünf Jahre später erinnert er sich genau, was dann geschehen war. Er notiert:
"Ich drücke meine beiden Daumen in die Höhlungen des Fleisches im Umkreis des Brustbeines und erreiche so langsam, den einen Daumen links, den anderen rechts schräg aufstützend, den härteren Bereich unter den Ohren". Mit einem Mal breitet sich große Müdigkeit in den Muskeln seiner Unterarme aus. Er schreibt: "Héléne guckt reglos und heiter, ihre offenen Augen starren zu Decke hinauf." Dann richtet sich Althusser plötzlich auf, begreift, was er getan hat, und schreit: "Ich habe Héléne erwürgt!"
Kurz darauf landet der völlig verwirrte Professor für Philosophie in einer psychiatrischen Klinik. Der Untersuchungsrichter bekommt aus dem Mann kein Wort heraus. Die französische Justiz erklärt Althusser, einen der großen Intellektuellen seiner Zeit, für unzurechnungsfähig. Sein Verfahren wird eingestellt und Althusser muss in der Klinik bleiben.
Fünf Jahre später - Althusser ist aus der Psychiatrie entlassen worden - beschreibt er die Tat in seinem Buch "Die Zukunft hat Zeit". Detail für Detail ringt er sich ab und fasst es in gedrucktes Wort. Er wendet die Tat auf den Seziertisch hin und her und bohrt tief, wo er meint, Erkenntnisse zu gewinnen. "Dieses Buch ist eben die Erwiderung, zu der ich sonst gezwungen worden wäre", reflektiert der Autor sein Vorgehen. Was ihn zum Schreiben veranlasst, ist die Tatsache, dass er kein öffentliches Verfahren erfahren hatte.
Die Tat zur Sprache bringen
Im Vorwort von "Die Zukunft hat Zeit" beschreibt Althusser, was dieser Umstand für ihn bedeutet: "[...] Wäre mir dieser Vorteil nicht zugutegekommen, hätte ich vor Gericht erscheinen müssen, hätte ich auch erwidern müssen." Um dieses Versäumnis nachzuholen, taucht er als Autor in seinem Buch in die Rollen des Ermittlungsrichters. Er sammelt und sichtet Dokumente, hört Zeugen. Am Ende führt er über sich selbst Gericht. Dieser fast literarische Schreib-Prozess ist weit mehr als der Versuch einer Verteidigung. Es handelt sich auch nicht um das narzisstische Bemühen, sich mit der Geschichte des verrückten Professors ein bisschen Ruhm zu sichern. Althusser hatte den existenziellen Wunsch, sein Handeln zur Sprache zu bringen.
Zurück in die Gegenwart und zu einem anderen Sachverhalt: dem deutschen Strafbefehlsverfahren. Durch einen Strafbefehl dürfen Gerichte Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung festsetzen, letzteres aber nur, wenn der Angeschuldigte anwaltlich vertreten ist. Wird dem Antrag, wie praktisch immer, durch das Gericht stattgegeben, findet (zunächst) keine Hauptverhandlung statt. Der Angeschuldigte kann sie lediglich durch Einlegen eines Einspruchs erzwingen. Das passiert aber in weniger als einem Drittel der Fälle.
Eigentlich gilt das Strafbefehlsverfahren als Ausnahme von dem Grundsatz der Strafprozessordnung (StPO), dass nur der bestraft werden darf, dessen Fall mündlich verhandelt wurde und der Gelegenheit zur Verteidigung bekam. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Ausnahme hat sich zur Regel gemausert – gegenwärtig sind gut zwei Drittel aller Verurteilungen zu einer Kriminalstrafe im Strafbefehlsverfahren erfolgt. Damit ist das Strafbefehlsverfahren schon jetzt der wichtigste Verfahrenstyp für die Ahndung der einfach gelagerten kleinen und mittleren Kriminalität.
Und die Beliebtheit des Strafbefehls steigt in Deutschland seit Jahren ähnlich rasant wie die von Helene Fischer: Besonders bei Staatsanwälten ist das Verfahren, das die Grundsätze der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit umgeht, ungemein populär. Schaut man sich die Gewichtung zwischen Anklagen und Strafbefehlsverfahrensanträgen an, stellt man fest: 2005 lag laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Strafbefehlsanträge der Staatsanwaltschaft bei 51,2 Prozent im Verhältnis zu 48,8 Prozent Anklagen. Im Jahr 2017 waren es bereits 55,6 Prozent Strafbefehlsanträge.
Das Mündlichkeitsprinzip als große Errungenschaft
Die Gründe für diesen Erfolgskurs sind die Üblichen: Ein Strafbefehlsverfahren kostet weniger Zeit und Geld und verursacht weniger Arbeit, was der chronisch überlasteten Justiz zu Gute kommt. Und in vielen Fällen ist das auch nachvollziehbar: Müsste plötzlich jedes einzelne Bagatelldelikt verhandelt werden, der deutsche Rechtsstaat würde kollabieren.
Der entscheidende Nachteil – und damit kommen wir zurück zu unserem Mörder-Professor: Genau wie dieser hat sich auch der durch den Strafbefehl Verurteilte einer mittelschweren Straftat nie mündlich zu den Anschuldigungen geäußert. Dabei gehört das Mündlichkeitsprinzip zu einer der größten Errungenschaften der Justizgeschichte – und es ist noch gar nicht so alt. Bis vor knapp 200 Jahren war man hierzulande der Auffassung, Akten alleine würden zur Prozessführung ausreichen. Noch Mitte des 19. Jahrhundert galt das sogenannte Aktenversendungsverfahren. Viele lokale Gerichte waren damals von juristischen Laien besetzt. Wenn die Laienrichter Zweifel darüber hatten, wie sie bei einer Sache entscheiden sollen, sendeten sie die Gerichtsakten an die Juristenfakultäten der Universitäten. Dort fertigten die Gelehrten Rechtsgutachten an und schrieben verkündungsfähige Urteile, sogenannte Consilia. Die Angeklagten wurden nicht gehört, sie durften sich lediglich ihre Strafe abholen.
Vorbei war es mit dieser Rechtspraxis erst 1879, als das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) die Trennung von Professoren und Richtern besiegelte. In §§ 12 ff. GVG legte es das Monopol der Gerichte auf die Rechtsprechung fest. Damit entfaltete die mündliche Rede in deutschen Gerichtssälen ihre Kraft. "Zusammen mit 'Unmittelbarkeit' und 'Öffentlichkeit' wurde sie auf dem Feld der Justiz das, was 'Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit' für die Revolution waren: Aufklärungsideale", beschreibt die Juristin und Soziologin Cornelia Vismann in ihrem Buch "Medien der Rechtsprechung" diesen gewaltigen Schritt in der Justizgeschichte. Er kann nicht überschätzt werden.
In der Stimme liegt die Unmittelbarkeit
Der Begründer einer empirischen Strafrechtswissenschaft, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, erklärte bereits 1821, wieso es ungenügend ist, Recht nur aufgrund von verschriftlichten Aussagen zu sprechen. Die Schrift bedeutet für ihn kein angemessenes Gegenstück zur Stimme. Der Rechtsuchende müsse vielmehr "unmittelbar selbst gehört werden". Denn die Stimme habe eben etwas, was der Schrift fehle: Unmittelbarkeit.
Warum dieses Alleinstellungsmerkmal des gesprochenen Wortes wiederum für die Wahrheitsfindung relevant ist, ist naheliegend. Bereits seit dem Mittelalter sind sich Gelehrte einig, dass für die Bewertung über ein Geschehen der richterliche Eindruck mitentscheidend ist. Beim modernen Strafbefehlsverfahren aber trägt Justitia plötzlich Ohropax.
Um sich Gehör zu verschaffen baute Professor Althusser sein Buch zum Gerichtssaal zwischen zwei Buchdeckeln um und inszeniert darin seinen eigenen Prozess. Er wollte, dass die Tat durch Aussprache zu einem Sachverhalt geformt wird, worüber die Öffentlichkeit abschließend urteilt.
Die Eintönigkeit des Kanzleistils
Sein dreihundertseitiges Werk schmückt er mit geradezu poetischer Eleganz aus. Dadurch aber wirkt sein Anliegen einer objektiven Verhandlung kalkuliert. Am Ende wundert es den Leser nicht, dass Althusser versucht, für sich einen Freispruch herauszuschlagen.
Das Problem von "Die Zukunft hat Zeit": Schlussendlich ist es nichts anders als ein in Eigenregie geführtes Aktenversendungsverfahren. Mündlichkeit und Unmittelbarkeit finden wieder nicht statt. Damit wirkt Althussers Vorhaben für den Leser wenig nachvollziehbar.
Was fehlt, damit wir dem Professor glauben wollen, beschreibt Gustav Radbruch, wenn er das Urteil, das rein nach Aktenlage gefällt wurde, kritisiert als "auf Grund von Zeugenaussagen, die nie mit eigenen Ohren zu Gesichte gekommen waren. Das Gebärdenspiel, das Erröten und Erbleichen des Beschuldigten, das Stocken der widerwilligen und das geläufige Hervorsprudeln der auswendig gelernten Zeugenaussage, alle Nuancen und Imponderabilien gehen in dem einförmigen Kanzleistil des Protokolls verloren." Eben dieser Mangel eint Alhussers Buch von 1985 und dem heute von Angeklagten unterschriebenen Strafbefehl.
Der Autor Alexander Rupflin ist Jurist, Autor und freier Journalist.
Das Mündlichkeitsprinzip: Wenn Justitia nichts hören will . In: Legal Tribune Online, 05.01.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33031/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag