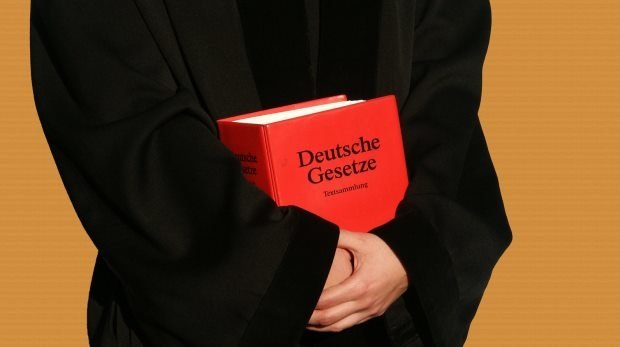Wie weit darf die Erledigungsquote eines Richters unter den Durchschnitt sinken, bevor er untragbar wird? Thomas Schulte-Kellinghaus erhielt 2012 eine Ermahnung, weil er nur auf 68% kam. Mit uns hat er erstmals über sein Verfahren gesprochen.
RiOLG Schulte-Kellinghaus ist den Meisten wohl nicht namentlich ein Begriff, sondern unter Bezeichnungen, die ihm die Medien in den vergangenen Jahren verliehen haben, und die je nach gewünschter Stoßrichtung und Sachkenntnis des Verfassers zwischen "der gründliche Richter", "der langsame Richter" und weiteren, nicht immer schmeichelhaften Zuschreibungen changierten.
Sein Verfahren gegen die inzwischen pensionierte Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe, Frau Prof. Dr. Christine Hügel, die ihn 2012 wegen seiner rund 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegenden Erledigungszahlen ermahnte, hat sowohl in der juristischen Fachpresse (Wittreck in NJW 2012, 3287 ff.) als auch in der Blawgosphäre und den Publikumsmedien Beachtung gefunden, und war auch auf der LTO schon Gegenstand mehrere Beiträge (etwa hier und hier).
Niemand sagt, er sei faul oder dumm
Das ist kein Zufall, denn in Schulte-Kellinghaus' Fall steht eine Frage erstmalig zur – nunmehr bald: höchstrichterlichen – Entscheidung, die seit Jahrzehnten im Inneren der deutschen Justiz schwelt, und die an das Grundverständnis richterlicher Unabhängigkeit und justizieller Ressourcenschonung rührt. Sie lautet, leicht vereinfacht: Wieviel Zeit darf ein Richter sich lassen, um ein Urteil zu fällen, das seinem eigenen Maßstab an ordentliche Rechtsanwendung genügt, und ab wann wird seine Langsamkeit zur unerträglichen Bürde für Kollegen, Rechtssuchende und das System der Justiz als Ganzes?
Die Sache wäre weniger interessant, wenn man Schulte-Kellinghaus leichthin als Faulenzer oder intellektuell Minderbegabten abtun könnte. Das indes behauptet niemand, auch Frau Hügel nicht. Im Gegenteil liegen seine wöchentlichen Arbeitsstunden deutlich über denen der meisten Kollegen, seine Urteile werden überdurchschnittlich häufig in Fachzeitschriften abgedruckt, und wer sich öffentlich über Schulte-Kellinghaus äußert, der beschreibt ihn vielleicht als schwierig oder eigenwillig, aber bestimmt nicht als träge oder dumm.
Er selbst hat sich zu seiner Klage, die vor dem Richterdienstgericht (RDG, Urt. v. 04.12.2012, Az. RDG 6/12) und dem Dienstgerichtshof für Richter (DGH, Urt. v. 17.04.2015, Az. DGH 2/13) erfolglos blieb und derzeit beim BGH anhängig ist, bislang nicht öffentlich geäußert. Auch wir mussten warten: Eine Interviewanfrage hatten wir bereits im April verschickt, doch er wollte sich zunächst die – seinerzeit noch nicht vorliegenden – schriftlichen Urteilsgründe des DGH ansehen.
"Urteil des DGH erlaubt der Landespolitik, Richter unter Druck zu setzen, damit diese ihre Rechtsanwendung ändern"
LTO: Herr Schulte-Kellinghaus, was an dem Urteil des DGH hat Sie bewogen, öffentlich über einen Sachverhalt zu sprechen, zu dem Sie seit über drei Jahren in der Presse geschwiegen haben?
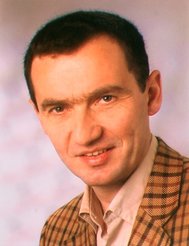 Schulte-Kellinghaus: Der DGH hat entschieden, dass Justizverwaltungen in Deutschland berechtigt sind, Richter unter Druck zu setzen, damit sie ihre Rechtsanwendung ändern. Richter können nach dem Urteil des Dienstgerichtshofs gezwungen werden, die Anwendung von Gesetzen den Interessen und Wünschen der Landespolitik anzupassen. Dazu möchte ich nicht mehr schweigen.
Schulte-Kellinghaus: Der DGH hat entschieden, dass Justizverwaltungen in Deutschland berechtigt sind, Richter unter Druck zu setzen, damit sie ihre Rechtsanwendung ändern. Richter können nach dem Urteil des Dienstgerichtshofs gezwungen werden, die Anwendung von Gesetzen den Interessen und Wünschen der Landespolitik anzupassen. Dazu möchte ich nicht mehr schweigen.
LTO: Das haben wir so im Tenor des Urteils vergeblich gesucht.
Schulte-Kellinghaus: Es ist aber sein sachlicher Inhalt. Es ging um die Frage, ob die Dienstaufsicht mich unter Druck setzen darf, damit ich höhere Erledigungszahlen produziere. Der DGH behauptet, Druck auf höhere Zahlen hätte nichts mit einem Druck auf eine – von der Präsidentin gewünschte – grundlegende Änderung meiner Rechtsanwendung zu tun. In diesem entscheidenden Punkt ist das Urteil begründungslos. Dass die in die Fallbearbeitung investierte Zeit und die somit erreichten Erledigungszahlen zwingend etwas mit unterschiedlicher Rechtsanwendung zu tun haben, ist evident. Das kann man nur leugnen, wenn man sich einer Wahrnehmung der Realität, wie Rechtsfindung an den Gerichten stattfindet, verschließt. Das haben die Richter des DGH getan.
"Das DGH-Urteil ist in sämtlichen Begründungselementen unzulänglich"
LTO: Welche handwerklichen Mängel sehen Sie in dem Urteil?
Schulte-Kellinghaus: Das Urteil ist in sämtlichen Begründungselementen unzulänglich. Es wird beispielsweise behauptet, es komme aus Rechtsgründen bei der Frage der richterlichen Unabhängigkeit gar nicht darauf an, ob die Präsidentin die Absicht gehabt habe, mich zu einer anderen Rechtsanwendung zu veranlassen. Das verstehe, wer will.
Der DGH behauptet weiter, vorsätzlich falsche Vorwürfe der Präsidentin – die im Zusammenhang mit der Ermahnung eine Rolle gespielt haben – könnten nicht den Zweck gehabt haben, mich unter Druck zu setzen oder einzuschüchtern. Auch das wird niemand, der den Dingen unvoreingenommen gegenübersteht, nachvollziehen können. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird in wesentlichen Punkten inhaltlich falsch zitiert. Umfangreiche Beweisanträge, die ich in der Verhandlung gestellt hatte, werden in den Urteilsgründen noch nicht einmal erwähnt.
"Richter sollen im Haushaltsinteresse buchstäblich kurzen Prozess machen"
LTO: Sie behaupten, die Maßnahmen der Präsidentin des OLG hätten etwas mit politischen Interessen zu tun. Wieso?
Schulte-Kellinghaus: Das wichtigste politische Ziel der Justizminister in den Bundesländern ist seit Langem die Ressourcenbegrenzung. Die Justiz darf nicht mehr kosten, als die Politik ausgeben möchte. Das geht nur, wenn man die Richter dazu bringt, ihre Rechtsanwendung der Haushaltspolitik in den Ländern anzupassen. Das ist eine verfassungswidrige Zielvorstellung, weil wir bei unserer Rechtsanwendung nur an die Gesetze gebunden sind, die wir anwenden müssen. Die Maßnahmen der Präsidentin dienten der Durchsetzung der haushaltspolitischen Ziele der Landespolitik gegenüber einem Richter, der seine Gesetzesbindung im Vordergrund sieht.
LTO: Aber warum soll es nicht möglich sein, einen Richter zu schnellerem Arbeiten anzuhalten, damit Verfahren zeitnah erledigt werden? Ähnliches ist doch in jedem anderen Beruf eine Selbstverständlichkeit.
Schulte-Kellinghaus: Weil das schnellere Arbeiten, von dem Sie sprechen, nur dadurch erreicht werden kann, dass der Richter seine Rechtsanwendung ändert, also Wege zu einem "kurzen Prozess" sucht. Weder die Präsidentin des OLG noch der DGH haben auf eine Möglichkeit hingewiesen, auf welche andere Weise ich zu höheren Erledigungszahlen kommen soll, wenn nicht durch geänderte Rechtsanwendung. Und das geht im Rechtsstaat nicht, verstößt gegen die richterliche Unabhängigkeit und steht der Gesetzesbindung des Richters entgegen.
2/4: "Die faulen Richter sind gerade die, die keine Probleme mit Erledigungszahlen haben"
LTO: Schlechte Erledigungszahlen liegen also stets nur an der Art der Rechtsanwendung – faule Richter gibt es nicht?
Schulte-Kellinghaus: Doch, es gibt faule Richter, wie es in jedem Beruf faule Arbeitnehmer gibt. Aber das sind in der ordentlichen Justiz in Deutschland nur diejenigen, die keine Probleme mit ihren Erledigungszahlen haben. Die wissen, wie man ein Verfahren "effizient gestaltet", die z. B. im Zivilprozess möglichst wenige Hinweise erteilen, Vortrag, der zusätzlichen Aufwand erfordern würde, als unsubstantiiert zurückweisen, oder die Parteien gleich in einen Vergleich bzw. einen Deal drängen.
Wenn Sie so arbeiten, können Sie ein effizienter Richter sein, und wenn Sie sich halbwegs geschickt anstellen, bleiben Ihre Entscheidungen dabei trotzdem berufungs- bzw. revisionsfest. So könnte ich auch arbeiten, so könnte ich meine Erledigungszahlen steigern – und genau deshalb stellt die allgemein formulierte Aufforderung, ich solle meine Erledigungsquote erhöhen, einen Eingriff in meine richterliche Unabhängigkeit dar.
LTO: Die Urteile der Kollegen, die im Schnitt 30 Prozent mehr schaffen, sind also um 30 Prozent schlechter als Ihre?
Schulte-Kellinghaus: Grundlage unserer Gesetzesbindung ist die richterliche Überzeugung, die wir uns bilden müssen. Das ist ein Kernbestandteil des Richtereids, in dem wir eine Entscheidung nur nach "bestem Wissen und Gewissen" versprochen haben. Die richterliche Überzeugung ist notwendigerweise bei verschiedenen Richtern unterschiedlich. Und daher führt eine überzeugungsgemäße richterliche Tätigkeit zu unterschiedlicher Rechtsanwendung, und damit zwingend zu einem unterschiedlichen Zeitbedarf, wobei die Unterschiede im Zeitbedarf pro Fall in der Praxis am OLG viel größer sind als nur 30 Prozent.
Jedem Richter steht seine eigene Überzeugung zu, in Kenntnis der Tatsache, dass andere Richter anders arbeiten. Wenn ich meiner Überzeugung folge, dann ist damit natürlich auch verbunden, dass ich meine Arbeitsweise und meine Rechtsanwendung für vorzugswürdig halte.
"Das System reguliert sich selbst – und lässt Ausreißer nicht zu"
LTO: Und wenn das eigene Rechtsverständnis und Gewissen des nächsten Kollegen bedingen, dass er nicht 70% des Durchschnittspensums schafft, sondern nur 50% oder 30% oder 10% - sind das dann alles Kosten, die der Staat und letztlich der Steuerzahler im Namen des Art. 97 GG zu schultern hat?
Schulte-Kellinghaus: Die Frage ist falsch gestellt, weil die Frage nach Zahlen als Maßstab unserer Tätigkeit mit dem Grundgesetz, mit dem Gerichtsverfassungsgesetz und mit unseren im Richtereid enthaltenen Verpflichtungen nichts zu tun hat. Außerdem geht sie an der heutigen Realität in den Gerichten vorbei. Wer niedrige Zahlen produziert, der schafft es gar nicht erst durch die drei- bis fünfjährige Probezeit, und würde auch danach dem sozialen Druck der Kollegen und den mehr oder weniger subtilen Gängelungen der Justizverwaltung nicht standhalten.
Das System reguliert solche Ausreißerfälle selbst, und zwar in der Regel ohne direkte Maßnahmen der jeweiligen Gerichtspräsidenten. Die Maßnahmen der Präsidentin des OLG Karlsruhe gegen mich waren, jedenfalls an einem Oberlandesgericht, neu. Normalerweise reicht der indirekte, aber hoch wirksame, Erledigungsdruck an den Gerichten aus, um Richter dazu zu bringen, in erster Linie für gute Zahlen zu sorgen, und diesem Ziel ihre Rechtsanwendung anzupassen.
LTO: Ziehen Sie bei den Erledigungszahlen also keine Grenze?
Schulte-Kellinghaus: Nein, ich ziehe keine Zahlen-Grenze, weil jede Grenzziehung der richterlichen Unabhängigkeit und dem Prinzip der Gesetzesbindung widersprechen würde. Außerdem gibt es, wie ich schon gesagt habe, kein praktisches Bedürfnis für Zahlengrenzen.
Die Schwankungsbreiten unterschiedlicher Zahlen dürften bei Richtern im Ergebnis deutlich geringer sein als quantitative Schwankungsbreiten in anderen intellektuell geprägten Berufen, wie beispielsweise bei Universitätsprofessoren oder Journalisten. Eine Rechtsprechung nach Durchschnittszahlen, wie es die Präsidentin des Oberlandesgerichts und ihr folgend der DGH verlangt haben, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch aus logischen Gründen absurd.
Mir ist im Übrigen bewusst, dass ein zahlenorientiertes Denken in der freien Wirtschaft eine wesentliche Rolle spielt. Aber als Richter sind wir nach unserem Richtereid verpflichtet, uns gegen Zahlenvorgaben zur Wehr zu setzen. Anders können wir unserer rechtsstaatlichen Verpflichtung nicht gerecht werden.
Noch nicht erwähnt habe ich übrigens die Schwierigkeit, Erledigungsquoten auf Grund der Unterschiedlichkeit der Fälle überhaupt sinnvoll zu vergleichen. 2012 hatte ich zum Beispiel einen Fall auf dem Tisch, in dem es 75 Kläger gab. Üblicherweise machen die Anwälte daraus nicht ein Verfahren, sondern 75. Wäre das hier auch so gewesen, hätte ich mit nur geringfügig höherem Zeitaufwand 75 Erledigungen verzeichnen können, anstelle von einer.
3/4: "Grundsatzurteile brauchen Zeit"
LTO: Aber solche Ungerechtigkeiten gleichen sich aus. Der Geschäftsverteilungsplan ist eine Lotterie – jeder zieht mal eine Niete.
Schulte-Kellinghaus: Nein, jedenfalls für die Zivilsenate eines Oberlandesgerichts stimmt Ihre Aussage nur zum Teil. Auch wenn man die Dinge über einen langen Zeitraum betrachten würde, was meist nicht geschieht, gleichen sich die unterschiedlichen Belastungen oft nicht aus, weil – unter anderem – die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Senate sich nicht vergleichen lassen. Außerdem haben zeitaufwändigere Entscheidungen auch andere Vorzüge. Gerade in höheren Instanzen können Sie einen Fall entweder schnell beiseiteschaffen, oder ein Grundsatzurteil fällen, das dann auf zahlreiche weitere Prozesse ausstrahlen wird. Letzteres bedeutet mehr Aufwand und geringere Erledigungszahlen.
Ich habe beispielsweise 2004 monatelang an einer Entscheidung gegen die Bausparkasse Badenia als Berichterstatter maßgeblich mitgewirkt. Zuvor hatte es schon sehr viele Klagen gegen das Unternehmen gegeben, die überwiegend erfolglos geblieben waren. Ich sah das in meinem Urteil anders, und bald darauf folgten 700 weitere Verfahren, in denen die Kläger überwiegend Recht erhielten. Ich will diesen Wandel nicht allein mir zuschreiben, wie immer kommen bei komplexen Vorgängen eine Vielzahl von Faktoren zusammen. Aber die damalige Entscheidung hat eine wesentliche Rolle gespielt – und sie war in der Erstellung viel aufwändiger als ein klageabweisendes Urteil, das einfach die Vorentscheidungen zitiert, es gewesen wäre. Dieser Vorgang ist nur ein Beispiel für die Unsinnigkeit des Zahlendenkens in der Justiz. Es lassen sich – gerade am OLG - viele andere Beispiele finden, die zeigen, wie unlogisch und letztlich verhängnisvoll das "Messen" einer angeblichen richterlichen Leistung an "Erledigungszahlen" ist.
LTO: Da war Ihnen die Justizverwaltung sicher gleich doppelt dankbar – dass Sie so viel Zeit auf ein Urteil verwendet haben, und dass darauf hunderte Folgeverfahren folgten.
Schulte-Kellinghaus: Die Justizverwaltung interessiert sich wenig dafür, ob Menschen zu ihrem Recht kommen oder nicht. Wir Richter sollten uns dafür interessieren.
"Wenn es konkret wird, halten sich viele Richter aus Angst oder Gewöhnung zurück"
LTO: Wenn das alles so ist, wie Sie es beschreiben, warum gibt es dann nicht einen viel größeren Aufschrei aus der Richterschaft? Von den beiden größten Berufsverbänden, dem Deutschen Richterbund und der Neuen Richtervereinigung, hat sich die eine überhaupt nicht und die andere nur zaghaft hinter Sie gestellt.
Schulte-Kellinghaus: Über die Motive einzelner will ich nicht spekulieren. Allerdings ist die Bereitschaft in der Richterschaft, sich mit dem System des Erledigungsdrucks und mit den Auswirkungen auf den Rechtsstaat und auf die betroffenen Bürger zu beschäftigen, niedrig. Abstrakte Diskussionen gibt es in geringem Umfang. Wenn es konkret wird, halten sich viele Richter zurück. Eine Bereitschaft zum notwendigen sachlichen Konflikt mit Gerichtspräsidenten und Justizministern ist in den Richterverbänden kaum vorhanden.
Für mich selbst sind die Dinge nicht einfach. Ich bin OLG-Richter, 61 Jahre alt und empfinde meine Situation als belastend. Was meinen Sie, wie oft sich das ein 35-jähriger Amts- oder Landrichter überlegt, der seine ganze Laufbahn noch vor sich hat?
4/4: "Zahlendruck führt zur Erosion des Berufsethos"
LTO: Gut 20.000 Richter im Land – und alles Duckmäuser?
Schulte-Kellinghaus: Wir Richter sind zum einen traditionell nicht besonders mutig; das gilt auch für mich selbst. Und zum anderen bestimmt das Sein mit der Zeit auch das Bewusstsein. Die Vorgabe von Erledigungszahlen hat in den letzten 20 Jahren zu einer teilweisen Erosion unseres Berufsethos geführt. Ich nehme mich davon nicht aus, auch wenn ich versuche, ihr entgegenzuwirken.
Erosion des Berufsethos heißt, dass für uns an die erste Stelle unseres Denkens das Erledigen von Fällen getreten ist, während die Anwendung von Recht, also Rechtsprechung nach bestem Wissen und Gewissen, nur noch an zweiter Stelle unseres Bewusstseins steht. Aber viele Kollegen können das entweder nicht sehen, weil sie sich so sehr daran gewöhnt haben, im Akkord zu arbeiten, oder sie wollen es nicht, weil sie es für unabänderlich halten. Wir müssen uns fragen, ob das die Justiz ist, die wir wollen.
"Zu welcher Reflexion der eigenen Tätigkeit und Situation werden die Richter am BGH in der Lage sein?"
LTO: Ihre Revision ist beim BGH anhängig, der für Fragen des Richterrechts die höchste Instanz bildet. Womit rechnen Sie?
Schulte-Kellinghaus: Ich weiß es nicht. Richterliche Entscheidungen sind generell nicht nur Erkenntnisakte, sondern oft auch Willensentscheidungen, was für die betroffenen Bürger, die eher an einen reinen Erkenntnisakt bei der Rechtsanwendung glauben, nicht leicht verständlich ist. Es ist aber ein Stück Rechtswirklichkeit. Die Entscheidung des Dienstgerichtshofs in Stuttgart sehe ich als reine Willensentscheidung, bei der ich eine Relevanz der 30-seitigen Begründung nicht erkenne.
Aus politischen Gründen und aus Gründen des eigenen richterlichen Selbstverständnisses wird es auch am Bundesgerichtshof in erster Linie nicht auf eine juristische Subsumtion ankommen, sondern auf einen Willensakt der Richter. Sind die Richterkollegen am BGH bereit und willens, sich mit dem Sachverhalt und dem Gegenstand des Verfahrens zu beschäftigen? Werden sie wahrnehmen, dass es bei der Zahlenfrage, jedenfalls am OLG, zwingend darum geht, dass Richter unter Druck gesetzt werden, um ihre Rechtsanwendung den Ressourcenbegrenzungen im Landeshaushalt anzupassen? Zu welcher Reflexion der eigenen Tätigkeit und der eigenen beruflichen Situation werden die Richter am BGH in der Lage sein? Ich kann es nicht vorhersehen.
Eines ist sicher: Wenn es im Ergebnis bei der Entscheidung des DGH bleiben sollte, dann würde dies weitreichende Auswirkungen auf die Kultur an den deutschen Gerichten haben. Ich weiß, dass viele Ministerialbeamte und Gerichtspräsidenten in Deutschland das Verfahren, das ich führe, sorgfältig beobachten. Der Druck auf Richter in Deutschland – Produktion von Erledigungszahlen statt verantwortungsbewusster und unabhängiger Rechtsanwendung – wird sich verschärfen, wenn die Entscheidung des Dienstgerichtshofs nicht aufgehoben wird. Die Pilotfunktion des Verfahrens ist für mich ein wichtiges Motiv, den juristischen Kampf für eine rechtsstaatliche Justiz – trotz der damit verbundenen persönlichen Belastungen – weiter zu führen.
LTO: Herr Schulte-Kellinghaus, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Thomas Schulte-Kellinghaus ist Richter am 9. Zivilsenat der Freiburger Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Er war bis 2011 Vorstandsmitglied der Neuen Richtervereinigung und ist Autor von Aufsätzen unter anderem zur Justizorganisation und richterlichen Selbstverwaltung.
Das Interview führte Constantin Baron van Lijnden.
Constantin Baron van Lijnden, Interview mit RiOLG Thomas Schulte-Kellinghaus: "Die Fixierung auf Zahlen ist von geringem intellektuellem Wert" . In: Legal Tribune Online, 21.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16243/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag