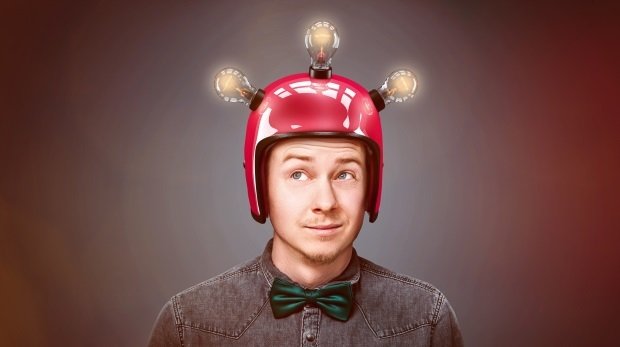Das EU-Einheitspatent ist so weit, dass es neben dem traditionellen europäischen Patentsystem starten könnte - wäre da bloß nicht der Brexit. Tilman Müller-Stoy und Armin Schwitulla erläutern das neue Konzept und warum es sich verzögert.
Vor 40 Jahren ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) für sieben Staaten in Kraft getreten. Es ermöglicht der innovativen Industrie in einem einzigen Verfahren Patentschutz in Europa zu erlangen. Dieses europäische Patentsystem hat sich als enormer Erfolg erwiesen: Die Zahl der beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereichten Anmeldungen stieg von rund 20.000 im Jahr 1980 auf über 160.000 im Jahr 2015, knapp 70.000 Patente wurden allein im Jahr 2015 erteilt. Das EPÜ ist nicht auf die Europäische Union (EU) beschränkt und umfasst mittlerweile 38 Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent Geltung erlangt.
Trotz seiner großen Akzeptanz ist das System nach wie vor unvollkommen: Die erreichte Vereinheitlichung beschränkt sich auf das Verfahren zur Erteilung eines Patents und die Möglichkeit Dritter, gegen diese Erteilung Einspruch einzulegen. Danach hat das europäische Patent die Wirkung eines nationalen Patents in den Vertragsstaaten, für die es erteilt ist. Das bedeutet, dass es für jeden einzelnen Staat aufrechterhalten werden muss.
Problem: EPÜ vereinfacht nicht die nationale Rechtsdurchsetzung
Dafür müssen Übersetzungen bei nationalen Patentämtern eingereicht und Jahresgebühren unter Beachtung verschiedenster Fristen und Verwaltungsvorschriften gezahlt werden. Nicht selten sind auch in den einzelnen Staaten Anwälte einzuschalten. Die Durchsetzung des Patents richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht. Ist das Patent von großer wirtschaftlicher Bedeutung, so muss der Patentinhaber mitunter Verfahren vor voneinander unabhängigen Gerichten mehrerer Länder betreiben, um die Benutzung durch Wettbewerber europaweit zu verhindern. Multinational geführte Verletzungsstreitigkeiten verursachen nicht nur hohe Kosten, sie bringen auch eine gewisse Rechtsunsicherheit mit sich.
Über viele Jahrzehnte hat es deshalb zahlreiche Bestrebungen gegeben, ein Patent zu schaffen, dessen Wirkungen auf allen Ebenen vereinheitlicht sind. Sie sind allesamt erfolglos geblieben, da es in wesentlichen Fragen nicht zu tragfähigen Kompromissen kam, insbesondere was Sprachenfragen und das Gerichtssystem angeht.
Das europäische Einheitspatent soll hingegen einen flächendeckenden, einheitlichen, effizienten und kostengünstigen Patentschutz schaffen.
Die Vorteile des EU-Einheitspatents
Strukturell ermöglicht dies das Einheitspatentsystem durch die zentrale Erteilung in einem einzigen Erteilungsverfahren, die zentrale Aufrechterhaltung durch Zahlung von Jahresgebühren an das EPA und gleichermaßen durch die gerichtliche Durchsetzbarkeit in einem einzigen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht mit Wirkung für alle teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten.
Es wird also – praktisch gesprochen – dem Inhaber dieses Einheitspatents möglich sein, durch ein Verfahren vor einem Gericht ein Urteil zu erlangen, dass es der Gegenpartei untersagt, patentgeschützte Produkte in allen Mitgliedsstaaten herzustellen oder zu vertreiben. Das Einheitspatent wird dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung als eine neue Option zur Verfügung gestellt, die neben das traditionelle europäische Bündelpatent tritt.
Teil des Einheitspatentsystems sollen alle EU-Staaten mit Ausnahme von Spanien, Kroatien und Polen sein. Damit sind also insbesondere die wirtschaftlich relevanten und damit für das Patentsystem besonders wichtigen Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien und – nach jetzigem Stand – das Vereinigte Königreich vorgesehen.
Das Einheitspatentgericht soll in der ersten Instanz aus einer Zentralkammer sowie Lokal- und Regionalkammern bestehen. Die Zentralkammer wird in Paris sitzen, zwei weitere Abteilungen in London (für Life Science) und München (für Maschinenbau). Wo Lokalkammern und Regionalkammern eingerichtet werden, entscheiden die Mitgliedstaaten. Deutschland wird seine Lokalkammern in München, Mannheim, Düsseldorf und Hamburg einrichten. Das Berufungsgericht wird in Luxemburg sitzen.
Ein Revisionsgericht ist nicht vorgesehen, allerdings ist das Einheitspatentgericht verpflichtet, rechtliche Zweifelsfragen des EU-Rechts im Wege der Vorabentscheidung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) klären zu lassen. Alle Spruchkörper des Einheitspatentgerichts sind multinational besetzt und werden von einem rechtlich qualifiziertenRichter als Vorsitzenden geführt.
2/2: Deutsch als Amtssprache
Einer der Kernstreitpunkte bei dem Aufbau des Einheitspatentsystems war die Sprachenregelung. Zwar hat man nicht die einfachste und kostengünstigste Lösung gewählt und ausschließlich Englisch zugelassen. Aber immerhin konnte man sich mit Englisch, Französisch und Deutsch auf drei Amtssprachen einigen, was jedoch maßgeblich zum Ausscheiden Spaniens aus dem Einheitspatentsystem beigetragen hat.
Verhandlungen vor den Lokal- oder Regionalkammern finden grundsätzlich in der jeweiligen Landessprache statt, allerdings kann das jeweilige Land die Benutzung weitere Sprachen zulassen. Vor der Zentralkammer ist die Sprache des erteilten Patents Verfahrenssprache. Die Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht wiederum ist diejenige aus der ersten Instanz.
Während einer mehrjährigen Übergangsphase besteht für das Bündelpatent eine parallele Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts und der nationalen Gerichte. Während dieses Zeitraums kann der Patentinhaber die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts für das Bündelpatent ausschließen (sogenanntes opt-out), etwa, weil er zunächst abwarten möchte, wie sich das System entwickelt.
Start des EU-Einheitspatents fraglich
Das Brexit-Referendum führte zu einer gewissen Schockstarre, denn das Vereinigte Königreich gehört neben Deutschland und Frankreich gegenwärtig zu den drei Staaten, deren Partizipation für das Inkrafttreten des Einheitspatentsystems rechtlich zwingend erforderlich ist.
Nach zwischenzeitlichen Überlegungen in anderen EU-Staaten, ein modifiziertes Einheitspatentsystem ohne das Vereinigte Königreich zu realisieren, kündigte die britische Regierung allerdings im November 2016 an, weiterhin partizipieren zu wollen und dies im Frühjahr 2017 durch Ratifizierung des nötigen Abkommens umzusetzen. Für diesen Fall könnte das System Ende 2017, Anfang 2018 starten.
Ob das allerdings tatsächlich so kommen wird, ist zunächst eine politische Frage, denn es bedarf hierfür weiterer parlamentarischer Akte des Vereinigten Königreichs. Hinzu treten rechtliche Hürden: Theresa May hat wiederholt und nachdrücklich als wesentliches Ziel des Brexit betont, die Zuständigkeit des EuGH für das Vereinigte Königreich zu beenden.
Der "harte" Brexit wird zum Problem
Nun ist zwar das Einheitspatentgericht kein Gericht der EU, es hat aber Zweifelsfragen des von ihm anzuwendenden EU-Rechts dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. Dazu gehören die beiden Verordnungen über das Einheitspatent sowie verschiedene EU-Richtlinien und in gewissem Umfang EU-kartellrechtliche Fragen.
Unter diesen Umständen verdient die vor dem Parlament abgegebene Erklärung von Jo Johnson, dem neuen IP-Minister des Vereinigten Königreichs, genauere Beachtung, nach der die Frage der Beteiligung von Nicht-EU Staaten am Einheitspatentgericht Teil der Austrittsverhandlungen sein wird. Da diese Frage sich in erster Linie für das Vereinigte Königreich selbst stellt, kann man eine Ratifizierung des Systems vor diesen Verhandlungen jedenfalls nicht sicher erwarten.
So wird sich auch die deutsche Regierung vor Hinterlegung der deutschen Ratifizierungsurkunde fragen müssen, ob sie ein System in die Welt setzen will, dessen Fortbestand vor Klärung der hier nur angedeuteten Probleme mit gravierenden Rechtsunsicherheiten belastet ist.
Zuverlässige Prognosen sind deshalb derzeit nicht möglich. Gegebenenfalls wird sich aber schon im Verlauf dieses Frühjahres eine Tendenz abzeichnen, denn Großbritannien plant, im März offiziell den Austritt zu erklären.
Dr. Tilman Müller-Stoy ist Partner bei Bardehle Pagenberg und dort als Rechtsanwalt Co-Praxisleiter der Patent Litigation Group. Sein Schwerpunkt liegt auf Patentstreitverfahren, insbesondere in grenzüberschreitenden Fallkomplexen. Er berät auch im Bereich Technologietransfer, vor allem beim Erwerb oder der Lizenzierung von Patenten.
Armin Schwitulla ist Rechtsanwalt bei Bardehle Pagenberg und auf Patentstreitverfahren spezialisiert. Er hat einen Master of Law (IP) an der Queen Mary University of London absolviert.
Dr. Tilman Müller-Stoy und Armin Schwitulla LL.M., Das EU-Einheitspatent: Ein System mit Zukunft? . In: Legal Tribune Online, 20.02.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22144/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag