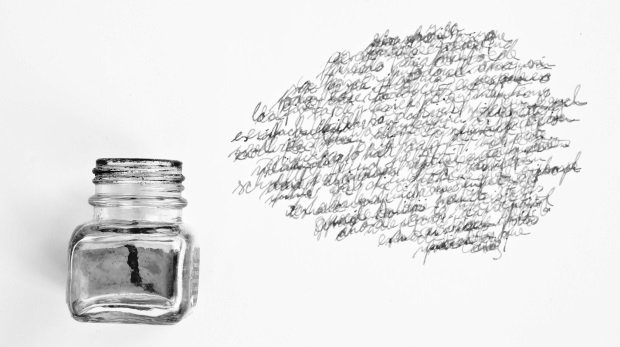Bislang hat die VG Wort ihre Einnahmen je zur Hälfte an Urheber und Verleger ausgeschüttet. Zu Unrecht, so der BGH. Die Einnahmen entstünden allein den Urhebern zu. Die Entscheidung könnte auch die GEMA treffen. Von Günter Poll.
Nach einem rund fünfjährigen Rechtsstreit zwischen einem wissenschaftlichen Autor, Dr. Martin Vogel und der Verwertungsgesellschaft VG Wort, hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit seinem am 21. April 2016 verkündeten Urteil klargestellt, dass die pauschale Beteiligung der Printverleger an den Einnahmen der VG Wort rechtswidrig ist und daher sofort eingestellt werden muss (Az. I ZR 198/13). Möglicherweise ergeben sich hieraus auch Regressansprüche der Autoren gegen die VG Wort und/oder die Verleger ihrer Werke.
Als Kompensation für die (gesetzlich erlaubten) massenhaften Privatkopien, die nach Veröffentlichung eines Werks oft erstellt werden, spricht § 54 Urheberrechtsgesetz (UrhG) dem Urheber einen Anspruch auf eine "angemessene Vergütung" zu, der sich gegen Hersteller von Speichermedien und Geräten, mit denen Werke kopiert werden können, richtet. Diese sogenannte Reprographieabgabe zieht die VG Wort zentral ein und zahlte sie, ihrem bisherigen Verteilungsplan entsprechend, zu 50 Prozent an die Autoren und 50 Prozent an die Verlage aus.
Damit hat es nach der heutigen Entscheidung ein Ende. Eine erste Bewertung ist zwar nur anhand der Pressemitteilung des BGH möglich, da die Urteilsgründe noch nicht vorliegen. Aus der Sicht der Verleger muss aber schon jetzt von einer katastrophalen Niederlage gesprochen werden. Dass der Rechtsstreit eher zugunsten der Autoren ausgehen würde, war zwar bereits seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Fall Hewlett Packard ./. Reprobel abzusehen, bis zu deren Verkündung der BGH das VG-Wort-Verfahren ausgesetzt hatte. Die heutige Entscheidung des BGH geht allerdings sogar noch über die des EuGH hinaus.
EuGH: Keine Verlegerbeteiligung per Gesetz
Der EuGH hatte im November 2015 entschieden, dass die belgische Rechtslage, die eine hälftige Teilung der Einnahmen der dortigen Verwertungsgesellschaft Reprobel zwischen Urhebern und Verlegern vorsah, mit europäischem Recht unvereinbar sei. Da die Verleger keine originären Inhaber des in Art. 2 der InfoSoc-Richtlinie genannten Vervielfältigungsrechts seien, stehe ihnen auch kein Anteil an dem durch Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie den Urhebern gewährten "gerechten Ausgleich" für die Einschränkung ihres Vervielfältigungsrechts und den daraus resultierenden massenhaften Privatkopien (= Reprographievergütung) zu.
Demgegenüber hatte die VG Wort in der Revision entscheidendes Gewicht auf drei Aspekte gelegt: Zum einen sei das EuGH-Urteil nicht 1:1 auf den Fall Vogel ./. VG Wort übertragbar, weil die Beteiligung der Verleger an den Einnahmen der VG Wort in Deutschland nicht (wie in Belgien) auf einer gesetzlichen Regelung, sondern auf ihrem Verteilungsplan und entsprechenden Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten (Urheber, Verleger und Verwertungsgesellschaft) beruhe. Zum anderen betreffe das EuGH-Urteil nur die Beteiligung der Verleger an der Reprographievergütung, während die VG Wort neben diesem Anspruch auch noch andere Vergütungsansprüche wahrnehme. Schließlich sei der Anspruch der Verleger auf Beteiligung an den Einnahmen der VG Wort schon deshalb berechtigt, weil die Verleger unstreitig zahlreiche Leistungen erbringen, die den Urhebern zugutekommen, und durch die die Verwertungsgesellschaften erst in die Lage versetzt werden, überhaupt Einnahmen aus der Reprographievergütung zu erzielen.
2/2: BGH: Rechteeinbringung entscheidend
Der BGH hat diese Einwände offenbar insgesamt für rechtlich irrelevant oder jedenfalls für nicht so relevant gehalten, dass sie die Aufhebung der von der VG Wort angegriffenen Entscheidung der Vorinstanz gerechtfertigt hätten. Vielmehr hat er die vom Oberlandesgericht (OLG) München vertretene Auffassung bestätigt, wonach es entscheidend auf die Frage der Rechteeinbringung ankommt: Die Verwertungsgesellschaft darf ihre Einnahmen grundsätzlich nur an diejenigen Berechtigten ausschütten, die ihr ihre Rechte auch anvertraut, d.h. zum Zweck der treuhänderischen Wahrnehmung in sie eingebracht (auf sie übertragen) haben.
Da die Verleger kein eigenes (originäres) Leistungsschutzrecht besitzen und auch über keine derivativen, d.h. von den Urhebern auf sie übertragenen Rechte verfügen, fehlt es an dieser Grundvoraussetzung. Die Verlegerbeteiligung verstößt daher - so muss man den Text der Pressemitteilung verstehen - gegen das Willkürverbot des § 7 Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes (UrhWG). Insbesondere macht es keinen Unterschied, ob die Beteiligung der Verleger (wie in Belgien) per Gesetz oder (wie in Deutschland) in den Statuten bzw. dem Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft geregelt ist. Dies gilt für sämtliche von der VG wahrgenommenen Vergütungsansprüche, nicht nur für die Reprographievergütung, auf die sich die Reprobel-Entscheidung des EuGH bezieht und beschränkt.
Urteil dürfte auch andere Verwertungsgesellschaften treffen
Darüber hinaus ist anzunehmen, dass sich das Urteil nicht nur auf die Vergütungsansprüche, sondern auch auf die von den Urhebern in andere Verwertungsgesellschaften (z.B. die GEMA) treuhänderisch eingebrachten Nutzungsrechte (bzw. die hierauf entfallenden Einnahmen) bezieht. Dafür spricht die Formulierung der Pressemitteilung ("Eine Verwertungsgesellschaft hat die Einnahmen aus der Wahrnehmung der ihr anvertrauten Rechte und Ansprüche ausschließlich an die Inhaber dieser Rechte und Ansprüche auszukehren"). Denn die von der Entscheidung unmittelbar betroffene VG Wort nimmt nur Ansprüche, keine Rechte wahr. Die GEMA hingegen generiert Einnahmen sowohl aus Vergütungsansprüchen wie auch aus den ihr ebenfalls anvertrauten Nutzungsrechten.
Allein der Umstand, dass die verlegerischen Leistungen es der VGes erst ermöglichen, Einnahmen aus der Werkverwertung zu erzielen, rechtfertigt es - so der BGH in seiner Pressemitteilung - jedenfalls nicht, einen Teil dieser Einnahmen an die Verleger auszuzahlen.
Keine Rückkehr zum bisherigen Zustand
Das bedeutet, dass eine Verlegerbeteiligung in Zukunft allenfalls über ausdrückliche (schriftliche) und eindeutige Abtretungserklärungen (diese gibt es bisher weder bei der VG Wort noch bei der GEMA), nicht aber durch den Verteilungsplan als solchen erreicht werden kann. In Bezug auf die Reprographievergütung ist dieser Weg aber sehr wahrscheinlich durch das Urteil des EuGH i.S. HP v. Reprobel (s.o) endgültig verschlossen, weil der EuGH in diesem Urteil keinen Zweifel daran gelassen hat, dass diese Vergütung ("gerechter Ausgleich") ausschließlich den Urhebern zusteht.
Erst Recht kann der deutsche Gesetzgeber nicht, wie unmittelbar nach dem Urteil vom Börsenverein gefordert, eine Regelung schaffen, wonach die Reprographievergütung doch wieder hälftig den Verlegern zufiele – denn genau dies hat der EuGH als europarechtswidrig verworfen.
Der Autor Dr. Günter Poll ist auf das Urheber- und Medienrecht spezialisierter Rechtsanwalt, war Lehrbeauftragter für das Urheberrecht an der Universität Regensburg sowie Justiziar des Bundesverbandes audiovisueller Medien. Davor war er als stellvertretender Justiziar bei der GEMA tätig.
Dr. Günter Poll, BGH kippt Gewinnverteilungsmodell der VG Wort: Worstcase für die Verleger . In: Legal Tribune Online, 21.04.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19169/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag