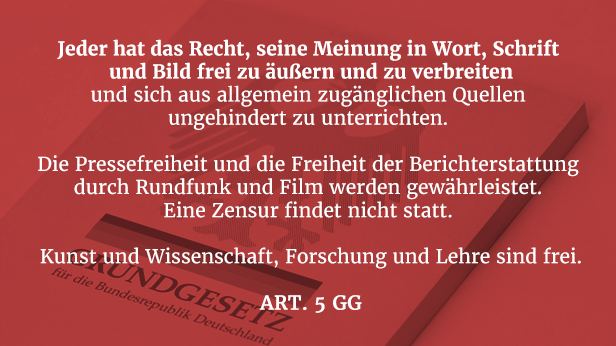In der Öffentlichkeit tobt ein Kampf um die Meinungsfreiheit – oder eine Scheindebatte? Was darf man noch sagen und wer sollte das bestimmen? Fragen, die auch jenseits des Atlantiks für Streit sorgen.
"Das wird man ja wohl noch sagen dürfen." Dieser Satz, der im allgemeinen Sprachgebrauch lange ein zwar omnipräsentes aber doch wenig beachtetes Dasein fristete, hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Karriere gemacht. Vom mürrisch dahergebrummten Schlagwort am Stammtisch hat er es zum Ausdruck einer relevanten gesellschaftlichen Strömung gebracht, die der Meinung ist, ihre Meinung nicht mehr sagen zu dürfen.
Das Phänomen ist nicht auf Deutschland beschränkt: In den USA tobt seit Jahren ein regelrechter Kulturkampf zwischen der Staatsräson von "freedom of speech" und der mehrheitlich auf den linksliberalen Campi der Ost- und Westküstenuniversitäten verorteten "political correctness". Letztere, so sehen es die mutmaßlich Freiheitsberaubten, zensiere den öffentlichen Diskurs, um zu vermeiden, dass Menschen unliebsamen Meinungen ausgesetzt würden. Ein Kampf, der auch den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf bestimmte und vielleicht mitentschied, in dem Hillary Clinton sich an die Seite von Minderheiten stellte und die "identity politics" der Linken bediente. Am Ende gewann der verbal ungezügelte Donald Trump.
In Deutschland hat die Meinungsfreiheitsdebatte vor allem im Laufe der Flüchtlingskrise an Fahrt gewonnen. Wer öffentlich etwas gegen den Zuzug von Asylsuchenden sage, so das Mantra von Konservativen und Rechten, werde sofort "in die Nazi-Ecke gestellt", um ihn mundtot zu machen. Doch nicht nur an einem Ende des Spektrums hört man solche Töne. Auch die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht beklagte erst kürzlich gegenüber ihrer Partei, jedem, "der eine differenzierte Sicht auf Migration einfordert", drohe gleich die Verbannung in die "Nazi-Ecke". Gleich, woher die Kritik kommt, das Feindbild ist hier wie in den USA das gleiche: Eine laute Minderheit von hypermoralisierten linken Eliten, die einer Mehrheit den Mund verbiete, um ihre kulturellen Wertvorstellungen durchzusetzen.
Meinung endet, wo Gefahr beginnt
Sollte dies wahr sein, wäre das problematisch. Denn das Grundgesetz garantiert in Art. 5 Abs. 1 die Meinungsfreiheit – zwar primär nur gegen den Staat, doch es bildet auch die Zielvorstellung einer freiheitlichen Demokratie ab. Wenn diese in Gefahr ist, kann das dem Staat nicht egal sein. Wenn aber in Rede steht, dass Bürgern ihr Recht auf freie Meinungsäußerung abgesprochen wird, dann muss zuvor festgelegt werden, was gesagt werden darf und was nicht. Wo also endet die schützenswerte Meinung?
"Für mich steht hinter dem Grundrecht der Meinungsfreiheit das der Gedankenfreiheit" erklärt Dr. Mathias Hong, Privatdozent für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. "Die Gedanken sind frei. Gegen die Gesinnung, gegen das Haben einer bestimmten Meinung kann und darf der Staat nicht mit Rechtszwang vorgehen" findet er. "Der Schutz für das Äußern einer Meinung endet deshalb nach dem Grundgesetz erst da, wo diese Äußerung andere Rechtsgüter gefährdet, etwa die Persönlichkeitsrechte anderer oder die Friedlichkeit des Zusammenlebens". Selbst extreme Meinungen, so Hong, könnten daher nicht einfach wegen ihres Inhalts verboten werden, sondern erst, wenn sie andere Rechtsgüter gefährden.
Was macht die Meinungsfreiheit aber so wichtig für eine funktionierende Demokratie? "Meinungsfreiheit ist für die Demokratie deshalb lebensnotwendig, weil keine Demokratie auf Dauer bestehen kann, wenn es ihr an Bürgerinnen und Bürgern fehlt, die sich am geistigen Meinungskampf beteiligen" erläutert Hong. "Die Meinungsfreiheit ist außerdem gerade in einer vorwiegend repräsentativen Demokratie wie der des Grundgesetzes besonders wichtig, um auch Minderheiten ein Protestventil zu geben, die sich in den Parlamenten nicht ausreichend vertreten fühlen. Das kann auch eine stabilisierende Funktion haben."
"Political correctness" als Kampfbegriff
In den USA scheint diese Stabilität indes verloren gegangen zu sein. Dort streitet man landesweit über die "political correctness" der Linken, die ihr von Konservativen unterstellt wird. Die Diskussionskultur ist überhitzt, man steht sich unversöhnlich gegenüber. Nicht erst seit der Präsidentschaft Donald Trumps ist das Land entzweit. Und auch in Deutschland scheint tatsächlich eine größere sprachliche Sensibilität Einzug zu halten, auf die sich nicht alle einigen können. Dies zeigte sich u. a. an der hitzigen Debatte um das Gedicht des Schriftstellers Eugen Gomringer an der Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule, das aufgrund sexistischer Inhalte entfernt wurde. Bringt also die "political correctness" das hohe Gut der Meinungsfreiheit und damit die Demokratie selbst in Gefahr?
Der Begriff der "political correctness" sei problematisch, meint Mathias Hong, "wenn er sich nicht auf staatliche Eingriffe bezieht, sondern als Kampfbegriff gegen die gesellschaftliche Ächtung bestimmter Positionen gebraucht wird." Die Meinungsfreiheit sieht er dadurch nicht verletzt, denn sie schütze nicht davor, dass die eigene Meinung von anderen als verwerflich beurteilt werde. "Demokratie ist nicht unbeschränkte Herrschaft von Mehrheitsstimmungen", betont der Verfassungsrechtler, "sondern beruht auf dem Gedanken, dass alle, gerade auch die Angehörigen von Minderheiten, einen unverfügbaren Status der Freiheit und Gleichheit besitzen, den auch die jeweilige demokratische Mehrheit stets berücksichtigen muss."
Meinungsfreiheit gegen den Staat – und auch Private?
Entscheidend für den Schutz der Meinungsfreiheit ist also auch, wer in sie eingreift. In den USA, so Hong, sei die Trennung zwischen staatlichem Eingriff und Streit unter Bürgern noch strenger vorzunehmen als in Deutschland, denn dort existiere keine mittelbare Drittwirkung der Verfassung. Die Meinungsfreiheit wirke nur zwischen Staat und Bürger, aber nicht zwischen Privaten. "Das bewirkt ein - aus europäischer Sicht - seltsames Auseinanderfallen zwischen einem sehr starken Schutz vor staatlichen Eingriffen und einem sehr schwachen Schutz der Meinungsfreiheit gegenüber privater Machtausübung." Zum Beispiel müssten weder Privatuniversitäten noch private Arbeitgeber, etwa bei Sanktionierungen durch Kündigungen, die Meinungsfreiheit beachten. „Free speech“ ja, aber eben nur gegen den Staat.
Das könne durchaus problematisch sein, findet Hong, beispielsweise dann, wenn etwa "die wichtige Rolle von Strafverteidigern in Frage gestellt würde, die jeden Angeklagten unabhängig davon verteidigen sollten, wie moralisch verwerflich seine Taten sind". Die Vorlage dafür bietet zur Zeit der Fall des Strafverteidigers von Harvey Weinstein, der jüngst seinen Posten als Dekan der juristischen Fakultät an der Elite-Universität Harvard verlor. In Deutschland wäre das wohl nicht so einfach möglich, gerade Kündigungen aufgrund moralischer Verfehlungen sind Unternehmen nicht erlaubt.
Während aber der Staat seinen Bürgern jenseits des Atlantiks den Mund fast unter keinen Umständen verbiete darf, werden hierzulande wiederum bestimmte Äußerungen durchaus unter Strafe gestellt. Beleidigung oder gar Volksverhetzung sind dort vielerorts gar nicht sanktioniert. Auch den Holocaust kann ungestraft leugnen, wer will. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist also schwächer gegen den Staat, wirkt dafür aber auch gegen Private.
Woher das ambivalente Verständnis der Amerikaner von Meinungsfreiheit rührt, ist schwer auszumachen, ebenso, welches Modell nun das bessere ist. Die Entwicklung hin zu einem fast absoluten Meinungsschutz gegen staatliche Eingriffe habe sich in den USA erst im Laufe des 20. Jahrhunderts, im Wesentlichen wohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben, konstatiert Hong. Eine grundsätzlich gute Entwicklung, findet er: "Der kompromisslose Schutz politischer Rede hat aus meiner Sicht durchaus Vorbildcharakter und Europa könnte sich davon durchaus eine Scheibe abschneiden, etwa auch wenn man nach Frankreich oder in das Vereinigte Königreich blickt", so Hong. Gleichwohl spiele in den USA auch "eine allgemeine Skepsis gegenüber staatlicher Regulierung" eine Rolle, "insbesondere bei der jetzigen, nun schon seit geraumer Zeit mehrheitlich eher konservativ geprägten Besetzung des U.S. Supreme Court".
"Mehr Rede" als Antwort auf den Totalitarismus
In Deutschland ist das Verständnis der Meinungsfreiheit in nunmehr 70 Jahren Grundgesetz relativ konstant geblieben, trotz neuer Entwicklungen, die damals nicht vorherzusehen waren. Die Dominanz digitaler Diskursplattformen wie Facebook oder Twitter zählt sicherlich dazu. Doch die bis heute maßgeblichen Grundlagen legte das Bundesverfassungsgericht schon 1958 in seinem berühmten Lüth-Urteil. Welche Antworten aber gibt das Grundgesetz auf die brennende Frage, wieviel freie Rede die Demokratie braucht?
Aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, die das Grundgesetz wesentlich mitprägte, könne man ganz unterschiedliche Lehren für die Meinungsfreiheit ziehen, meint Mathias Hong. "Viele sehen sie als Argument dafür, die Meinungen, die zu diesen Menschheitsverbrechen geführt haben, möglichst zu verbieten und zu unterdrücken." Dann aber führt er das Beispiel von Gerald Gunther, Professor in Stanford, an, der für sich eine gegenteilige Lehre zog: Als jüdisches Kind hatte er in Deutschland selbst antisemitische Anfeindungen erlebt und floh mit seinen Eltern 1938 in die USA. Dort sei er zu einem der wichtigsten Verfechter der Meinungsfreiheit geworden, erzählt Hong.
"Ich denke, dass die verfassungsgebende Gewalt des Grundgesetzes einen ähnlichen Schluss gezogen hat: Die Verfassung muss sich verteidigen, deshalb gibt es Vorkehrungen wie das Parteiverbot. Ansonsten aber liegt der beste Schutz vor einem Rückfall in eine autoritäre Diktatur gerade in einem robusten Schutz der Meinungsfreiheit." Die Antwort müsse "mehr Rede" lauten, "nicht erzwungene Stille" zitiert er. Der Satz stammt von Louis Brandeis, dem ersten jüdischen Richter am Obersten Gerichtshof der USA.
70 Jahre GG – die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG: Darf man das noch sagen? . In: Legal Tribune Online, 19.05.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/35435/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag