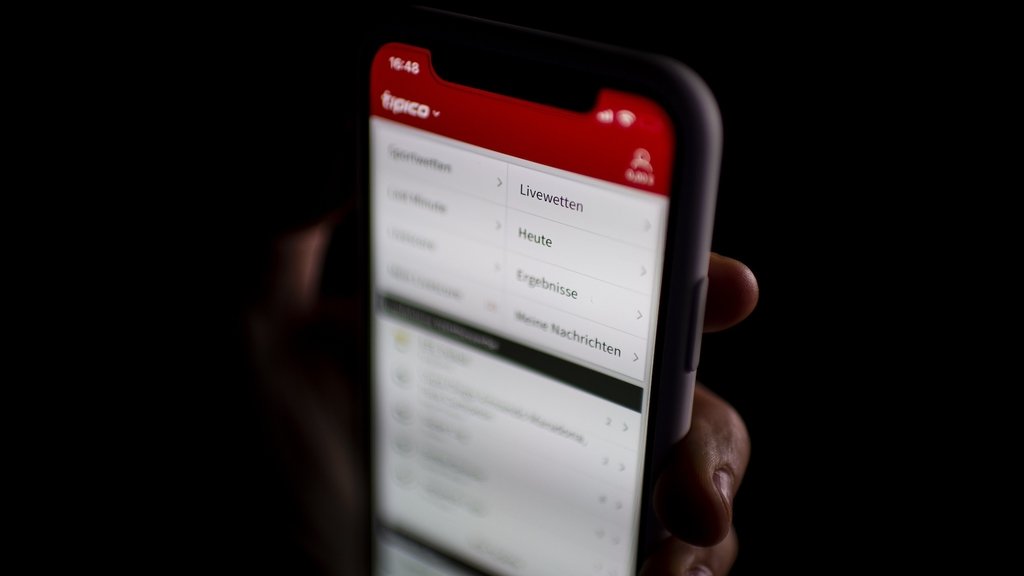Stilistisch ist das Buch "Ich beantrage Freispruch" ein Desaster. Darüber können nicht einmal großartige Inhalte hinweg trösten, denn derartiges findet sich auf den rund 500 Seiten nicht, meint Lorenz Leitmeier.
Ein Dandy im karierten Mantel mit riesengroßem Revers, vor das rechte Auge ein Monokel geklemmt – bereits auf dem Titelbild von Erich Freys Erinnerungen: "Ich beantrage Freispruch" bleibt kein Zweifel: Hier ist ein "Star-Verteidiger" auf dem Weg ins Gericht. Erich Frey war der bekannteste Strafverteidiger der 1920er Jahre. Schon 1959 erschien sein Buch, dessen Klappentext lebhafte und farbige Schilderungen aus Sensationsprozessen der Weimarer Republik verspricht, vorgetragen mit Witz, feiner Ironie und auch Mitgefühl.
So ist die Vorfreude groß – und nach 100 Seiten die Ernüchterung, nach 300 die Verzweiflung und nach knapp 500 die Freude über das Ende der Lektüre. Die "Erinnerungen" sind gar keine, die Schilderungen so bunt wie "Aktenzeichen XY", und der rechtliche Gehalt so dünn wie Brühe.
Zunächst eine Klarstellung: Die "Erinnerungen" Freys sind keine Memoiren im eigentlichen Sinne. Über den Autor, sein Leben und seine soziale Rolle als Anwalt in der Weimarer Republik erfährt man nämlich so gut wie nichts. Mit Ausnahme von insgesamt zehn Seiten "Eröffnung" und "Schlussplädoyer", die einige wenige äußere Stationen seines Lebens streifen, berichtet Frey kaum über sich.
Der Rest, und das sind 470 zähe Seiten, ist eine Sammlung von "sensationellen" Fällen, von Serienmördern abwärts bis hin zu "Ärzten auf der Anklagebank". Auch der Titel "Ich beantrage Freispruch" ist irreführend, denn der Verteidiger beantragt nur selten Freispruch. Wie sollte er das auch ernsthaft bei Serienmördern?
Die Form: Literarisch wertlos
Formell ist das Werk ein Desaster, von Literatur so weit entfernt wie Freys Mörder vom Freispruch: Dass man für Geschichten aus dem Strafgericht keine Nebensätze braucht, sondern im atemlosen Asthma-Stil Hauptsatz an Hauptsatz reihen kann ("Aber schon wenige Sekunden später geht die Tür wieder auf. Jeder von ihnen hält in der Rechten einen Revolver, in der Linken eine Blechmarke. 'Kriminalpolizei'! Wir verhaften Sie wegen Raubmordes. Ruhig steht Schumann auf. Kein Erstaunen, kein Erschrecken, kein Fluchtversuch.") – das kennt man von Ferdinand von Schirachs Geschichtchen.
Frey aber schreibt durchgehend, als seien Erzählperspektiven eine sinnlose Erfindung, als könne man gleichzeitig der allwissende Erzähler sein, in einzelne Rollen schlüpfen, neutral das äußere Geschehen erzählen und zugleich seine eigene Sicht einbringen. Eine Grenze zwischen Dokumentation und Fiktion gibt es auch nicht: Frey schildert Unterredungen, die er mit seinen Mandanten geführt hat, und verfasst gleich darauf wörtliche Dialoge von Personen, die er nie getroffen hat. Die Unterhaltungen sind gekünstelt und langatmig, die Sperrholz-Sprache wird auch nicht originell, weil Frey seine Figuren penetrant Dialekt sprechen lässt ("Ja, wenn ick die Jröße und Fijur in Betracht ziehe, würde ick sagen: Det warn se…"). Ist es dramaturgisch nötig, beobachtet Frey den ganzen Prozess hindurch das Verhalten einer Zuschauerin. Sein Mandant muss diese Unaufmerksamkeit des Verteidigers wohl akzeptieren, selbst wenn es um Zuchthaus geht.
Ebenfalls austauschbar behandelt Frey Zeiten: Eben noch schrieb er im Imperfekt, erzählt uns dann im Präsens, weshalb der Polizist gestern das Verhör beendet hatte, und ist dann im Perfekt in seine Kanzlei gegangen. Da macht es schon nichts mehr, dass "wo" zum Universal-Relativpronomen wird ("Eine Schlägerei war etwas, wo man dabei gewesen sein musste.")
Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass sich Geschichten aus dem Strafrecht von selbst schreiben. Das Gegenteil ist richtig: Schreiben ist schwer, und niemand zaubert 500 Seiten Spannung, Tiefgang und elegante Dialoge auf das Papier. Ein Autor muss interessante Charaktere darstellen, die eine Entwicklung durchmachen, Handlungsstränge abstimmen und realistische Unterhaltungen ersinnen. Frey kann das nicht, leider.
Spektakuläre Mandate in schaler Abfolge
Dass ein Strafverteidiger nicht mit überreichem Schreibtalent gesegnet ist, kann man hinnehmen. Frey aber teilt dem Leser auch inhaltlich nichts von Bedeutung mit. Seine Mandanten bleiben blass und leer, über ihre Absichten, Motive, Hintergründe erfährt man nichts. In schaler Abfolge werden vermeintlich spektakuläre Mandate zusammengefasst, allerdings ohne Prägnanz, mit Abschweifungen in irrelevante Nebenstränge und zu Personen, die drei Absätze später verschwinden.
Das Verhältnis von Verteidiger und Mandant wird nicht thematisiert; welche Verteidigungsstrategien Frey anwendet, welche Gespräche er im Gefängnis führt, welche Kämpfe er mit sich und dem Mandanten ausficht – es bleibt offen. Spannende Fragen tippt Frey höchstens an: Einmal teilt er dem Leser mit, dass Beschuldigte oft ihren Anwalt anlügen. Was aber folgt daraus? Wie kämpft man an mehreren Fronten, mit der Polizei, mit dem eigenen Mandanten? Man erfährt es nicht – stattdessen aber, dass in der Kanzlei Smyrna-Teppiche auf dem Boden liegen, in denen der Fuß des Besuchers versinkt, zahlreiche hübsche Sekretärinnen arbeiten, und der Mandant von einem Boy in einer lichtgrünen Livree empfangen wird, auf die ein "F" gestickt ist.
Und wenn Frey einmal seine Rolle beleuchtet, hätte er besser geschwiegen: Als in der "Steglitzer Schülertragödie", Freys wichtigstem Fall, der Richter den Angeklagten Paul Krantz fragt: "Diese Schule besuchten Sie noch, als Sie im Anschluss an Ihre Tat verhaftet wurden?", erkennt Frey diese Suggestiv-Falle: "Wenn Paul jetzt ja sagt, legt er ein Geständnis ab."
Was aber macht der "Star in schwarzer Robe" (so das Nachwort) in dieser Situation? Geht er dazwischen und schützt seinen Mandanten? Weist er die Frage zurück, stellt er einen Befangenheitsantrag? Nein, ganz anders: "Ich höre gespannt. Was wird Paul antworten?" Für einen Strafverteidiger ist das nahe am Super-Gau: Der Mandant ist in Gefahr, sich um seinen Kopf zu reden – und der Anwalt wartet gespannt…
Fälle sind rechtlich langweilig
An einer anderen Stelle, als es um den "Massenmörder" Fritz Haarmann geht, fragt der Psychologe Lessing, ob eigentlich die Moderne mit ihren "elenden Steinkästen der Häuser" und "Steinschluchten der Straßen" auch eine Rolle spiele, wenn einzelne Menschen zu Serienmördern werden? Und wie man dazu stehen solle, wenn fünfhunderttausend Tote einen Orden, fünfzehn Tote aber Zuchthaus einbringen? Frey findet das interessant, bricht aber den Gedanken ab – und erzählt, dass Lessing von der Sachverständigen- auf die Pressebank verwiesen wurde.
Rechtlich sind die Geschichten bedeutungslos und langweilig: Mord und Totschlag sind juristisch ohne Schwierigkeit, und adlige Damen, die aus Langeweile oder Überheblichkeit klauen – wen interessiert das?
Verrat an den Mandanten
Das Schlimmste an diesem Werk ist aber der menschliche Verrat, den jeder Strafverteidiger an seinen Mandanten begeht, wenn er ihr Schicksal ausschlachtet und sie der Öffentlichkeit vorführt. Auf Seite 290 berichtet Frey vom guten Rat eines Vorsitzenden, der zu Beginn der Sitzung sagt: "Ich lege allen Beteiligten dringend ans Herz, die vielen schwierigen Dinge, die hier verhandelt werden, so nach außen weiterzugeben, dass niemand Schaden erleidet."
Frey missachtet diesen Rat grandios: Seine Mandanten bezeichnet er als "abseitige Kreaturen", schreibt über Haarmann als einem "Wolf in Menschengestalt", beim Serienmörder Grossmann habe er "einem Unmenschen in die unverhüllte Fratze geblickt." Vielleicht verdienen diese Menschen wenig Empathie, aber solch eine Differenziertheit schafft auch die Bild-Zeitung jeden Morgen, wenn es "Post von Wagner" gibt. Und wenn Frey das "Ungeheuer" Haarmann vorstellt, das aus den Morden eine Weltberühmtheit ableitet, fragt man sich: Führt Frey jetzt Haarmann vor, oder erreicht Haarmann nicht doch über Frey, was er will? Frey jedenfalls erkennt diese Dialektik nicht.
Als Quintessenz der Geschichten bleibt: Man sieht es keinem Menschen an, ob er ein Mörder ist. Im Übrigen wird von Serienmördern über Unterwelt-Ganoven bis hin zu Kaufhaus-Diebinnen ein unpräziser äußerer Sachverhalt erzählt, sodass nach 480 Seiten eine zunehmend langweilige Parade von sozial Auffälligen an einem vorübergezogen ist. Hat man dieses Buch endlich hinuntergequält, sind viele Stunden verschenkt. Aber, wie gesagt, zum Glück ist man ja Beamter: Kein "L" auf die dunkelschwarze Robe gestickt, dafür aber genug Zeit.
Der Autor Dr. Lorenz Leitmeier ist Richter am Amtsgericht und hauptamtlicher Dozent an der Hochschule für den öffentlichen Dienst (HföD) in Starnberg.
Renzension von "Ich beantrage Freispruch": Literatur ist das nicht . In: Legal Tribune Online, 09.03.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/34285/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag