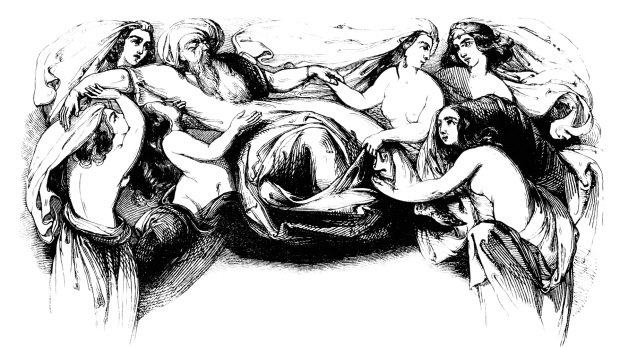Was tut der englische Bigamist, um die Todesstrafe abzuwenden? Einen Psalm sprechen. Kaum ist Ostern vorbei, steht schon die Hochzeitssaison vor der Tür: Rechtshistorischer Small-Talk-Stoff aus England, der überrascht und erschreckt.
Vor knapp 12 Jahren, am 9. April 2005, heirateten der britische Thronfolger Charles, Prince of Wales (1948–), und seine zweite Verlobte, Camilla Parker Bowles (1947–). Vorangegangen war so manches Gerede, da es sich um eine zweite Ehe handelte, auch wenn wohl niemand mehr so weit gegangen wäre, den amerikanischen Journalisten Ambrose Bierce (1842–1914) zu zitieren: "Bigamie, die – Geschmacksverwirrung, für die künftige Weisheit eine Strafe namens Trigamie verhängen wird."
Bevor Sie, verehrte Leserin, lieber Leser, nun denken, Sie seien hier in einen Gastbeitrag von Rolf Seelmann-Eggebert hineingeraten: Sobald im Folgenden einer der Umstände dieser blaublütigen Britenhochzeit abgehakt ist, werden wir allenfalls noch Monarchen erwähnen, die der größte deutsche Adelsreporter um ein paar Jahrhunderte verpasst hat.
Bigamie trotz Scheidung?
Es mag verwundern, doch lag im Jahr 2005 auf der Vermählung des Prinzen mit seiner langjährigen Freundin tatsächlich ein Hauch von Bigamie: Denn noch bis zum Jahr 2002 war die Church of England nicht bereit gewesen, die Trauung einer geschiedenen Person vorzunehmen, solange mindestens einer der vormaligen Ehepartner der Brautleute noch unter den Lebenden weilte. Erst seit 2002 steht es unter besonderen Umständen im Ermessen des jeweiligen Priesters, auch Geschiedene mit lebendem Ex-Gatten einer neuen kirchlichen Ehe zuzuführen.
In diesen Vorbehalten der anglikanischen Staatskirche, die 2005 im Fall von Charles und Parker Bowles zu einer Ziviltrauung Anlass gaben, spiegelt sich eine jahrhundertelange Einstellung des englischen Rechts zur Ehe wider, die der an der Emory University School of Law, Atlanta, tätige Professor John Witte unlängst unter dem Titel "Prosecuting Polygamy in Early Modern England" in einer Darstellung voll garstiger Details beschrieb.
Witte widmet seine Aufmerksamkeit einem Gesetz mit dem schönen Langtitel: "An Act to restrain all Persons from Marriage until their former Wives and former Husbands be dead", kürzer meist als "Bigamy Act 1603" zitiert, erlassen unter der Regierung von König Jakob I. (1566–1625).
Geschiedene blieben einander weit stärker verbunden als heute: Normalsterbliche Untertanen, die sich scheiden ließen, bewirkten damit allein die Trennung von Tisch und Bett und die Auseinandersetzung ihrer Vermögensverhältnisse – eine zweite Heirat vor dem Tod des Ex-Gatten kam nur für jene wenigen Geschiedenen in Frage, die in den Genuss eines sogenannten "Private Acts" kamen. Zur Regelung der persönlichen Verhältnisse – des Personenstands oder der Staatsangehörigkeit – erließ das britische Parlament gelegentlich Einzelfallgesetze, ein teurer und selten gangbarer Weg.
Wer nach einer konventionellen Scheidung eine Ehe schloss, obwohl er oder sie von Rechts wegen bereits verheiratet war, beging nach dem Bigamy Act 1603 ein Schwerverbrechen ("felony"). Diese Regelung blieb bis 1828 – bei zwischenzeitlich verschärften Rechtsfolgen – in Kraft.
Sanktionen reichten von Geld- bis Todesstrafe
Als Sanktionen für das Schwerverbrechen der Bi- bzw. Polygamie kamen neben der Todesstrafe die Verschiffung in eine der Kolonien – meist verbunden mit dem Verkauf in die sklavereiähnliche Knechtschaft –, gelegentlich eine Haftstrafe, nicht selten eine Geldstrafe in Betracht.
Um nur einen der zahlreichen von Witte berichteten Beispielsfälle herauszugreifen: Der Tabakhändler Thomas Brown heiratet im Februar 1747 ein Dienstmädchen namens Ann Mussells. Ein halbes Jahr später lernt er in einer Schankwirtschaft seine zweite Frau, Susannah Watts, kennen. Sie verleben Flitterwochen, doch als er sie nach Hause bringt, wartet dort immer noch die empörte Erstgattin, die nun ihren Mr. Brown vor den Kadi bringt. Das Gericht drückt zwar – mit Blick auf die Vorstrafen dieses Mannes – die Hoffnung aus, ihn wegen der Bigamie endlich auch einmal zum Tode verurteilen zu können (noch bei Abschaffung der Todesstrafe heißt es in den 1960er Jahren, das Hängen sei neben der Fuchsjagd nun einmal eine britische Tradition), doch entgeht Thomas Brown durch das sogenannte "benefit of clergy" dem Galgen:
Wer lesen konnte, kam glimpflich davon
Nicht bei jedem, aber doch bei einigen Schwerverbrechen ließ sich die Todesstrafe durch eine den Strafanspruch ändernde Einwendung vermeiden: Wer in der Lage ist, den 51. Psalm zu lesen – in einer Gesellschaft voller Analphabeten Beleg genug, zum lebenswerten gebildeten Stand ("clergy") zu zählen – kommt im Fall der Mehrfachehe damit davon, dass der Daumen mit einem "B" für "Bigamist" oder mit einem "P" für "Polygamie" gebrandmarkt wird.
Für Frauen wird das Privileg 1691 eingeführt, vorher stand es allein Männern zu.
Weniger glücklich als dem lesekundigen Mr. Brown ergeht es 1723 einem Friseur französischer Herkunft namens Lewis Houssart, der bei seiner Hochzeit so nervös wirkte, dass die Behörde beim Pfarrer der französischen Exilgemeinde nach dem Vorleben des Bräutigams fragte. Dies förderte eine erste Ehe nebst Behauptung eines Schwagers zutage, Houssart habe seine erste Gattin ermordet. Bei reichlich dünner Beweislage wurde der Friseur vor dem bekannten Gerichtsgebäude Old Bailey – wegen Bigamie und(!) Mordes – zum Tod verurteilt. Witte merkt böse an, es werde aus den Akten nicht klar, ob der französische Friseur überhaupt versucht habe, seinen Kopf mit dem "benefit of clergy" aus der Schlinge zu ziehen, doch sei ohnehin zweifelhaft, ob der Franzose den 51. Psalm zur Zufriedenheit englischer Richter akkurat hätte vortragen können.
Erst seit 1717 kann auch bei vorliegendem "benefit of clergy" die Deportationsstrafe ("transportation") verhängt werden, 1827 schafft der britische Gesetzgeber das archaische Institut der Strafmilderung qua Nachweis der Lesefähigkeit ab.
2/2: Der Staat strafte Bigamie weit härter als die Kirchen
Über diese eher anekdotischen Vorgänge auf dem Gebiet des Ehestrafrechts hinaus – John Witte schildert sogar einen aktenmäßig dokumentierten kitschromantischen Fall, in dem ein kostümiertes Dienstmädchen seine Herrin vor den Avancen eines mutmaßlichen Schwindlers schützt, indem es ihn selbst heiratet – geben die Ausführungen des Juraprofessors aus Atlanta noch einen ganz ernsthaften Zweifel von allgemeinerem Interesse auf, der sich in aktuellen rechtspolitischen Diskussionen gebrauchen lässt.
Wir sehen das Recht der Gegenwart oft und gern als Frucht säkularer, moderner Staatlichkeit, als einen Zustand, den es gegen die Zumutungen zu schützen gilt, die in den stets archaischen und brutalen Normvorstellungen religiös hergeleiteten Rechtsdenkens zu erkennen sein sollen.
Im Fall des alten englischen Bigamie-Verbots war es nun freilich gerade umgekehrt: Bis Heinrich VIII. (1491–1547), den man gerne im Interview mit Rolf Seelmann-Eggebert erlebt hätte, seiner Herrschaft das Familienrecht unterzuordnen begann und das Londoner Parlament an jene Stelle setzte, die bis dahin der Papst innehatte, wurden Fälle von Bi- bzw. Polygamie vergleichsweise milde, fast ausschließlich kirchenrechtlich sanktioniert, beispielsweise mit dem Ausschluss des Bigamisten von den Sakramenten, etwa dem Abendmahl, sowie mit Beicht- und Bußpflichten.
Drakonische Anfänge der Säkularisierung
Nicht irgendein orientalischer Kult, sondern jenes Parlament, das als "Wiege der Demokratie" gehandelt wird, griff seit 1603/04 mit den hier skizzierten drakonischen Strafen in die persönlichen Verhältnisse von Männern und Frauen ein – weit über die Verteidigung jener nachvollziehbaren Ordnungsvorteile hinaus, die in der Monogamie mit Blick auf gemeinsame Kinder oder Vermögensinteressen liegen. Die Ausgeburten des frühen Parlamentarismus: es sind der Galgen, das Brandzeichen, die lebensbedrohende Verschleppung in überseeische Knechtschaft.
Dass der säkulare Staat seinen rechtsunterworfenen Subjekten die Moral nachhaltig einimpfte, war – wie erwähnt – noch darin zu bemerken, wie verschnupft die britische Öffentlichkeit auf die Legalisierung des – einst bigamistischen – Charles & Camilla-Konkubinats reagierte.
Vielleicht lädt dies dazu ein, in der Gegenwart den Heldengesang auf den säkularen Staat gelegentlich etwas weniger forsch anzustimmen und die Nase über alternative Herleitungen von Recht, z.B. aus religiösen Zusammenhängen, nicht allzu unbedacht zu rümpfen.
Hinweis: John Witte Jr.: "Prosecuting Polygamy in Early Modern England", in: ders., Sara McDougall und Anna di Robilant (Hg.): Texts and Contexts in Legal History: Essays in Honor of Charles Donahue, 2016, S. 429–448.
Autor: Martin Rath arbeitet als freier Lektor und Journalist in Ohligs.
Martin Rath, Strafbarkeit von Bigamie: Marry! Old England! . In: Legal Tribune Online, 17.04.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22665/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag