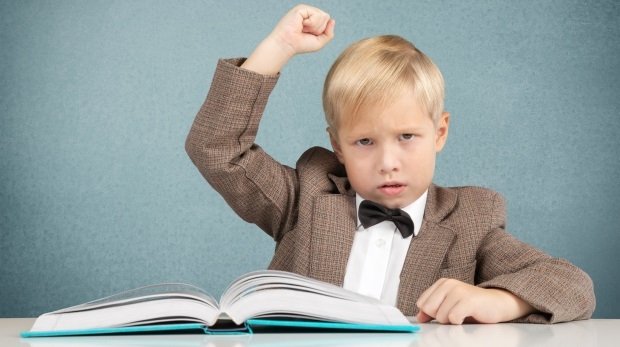Bald gehen die nächsten Schulanfänger an den Start, aber lernen die Kinder wirklich alles Wichtige? Dass ein Bedarf an juristischer Rabulistik existiert, belegt nicht zuletzt eine Auslegungsfrage zum Verzehr von Kängurus. Von Martin Rath.
Der Berliner Publizist und Philosoph Mathias Greffrath (1945–) rieb sich bereits in den 1980er Jahren bei der Feststellung die Augen, dass die Kinder an den deutschen Schulen so gut wie nichts über die drei Themen, die wirklich wichtig in ihrem Leben sein würden, lernten: Medizin, Ökonomie und natürlich Recht.
Stellt sich die Frage nach dem Status Quo: Hat sich - um nur das Recht aufzugreifen - daran bis heute wirklich etwas verändert?
Zwar hat die LTO etwa über die Bemühungen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland berichtet, über freiwillige Arbeitsgemeinschaften den Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 oder 10 ein wenig vom Recht in Deutschland zu vermitteln. Die Zahl von rund 850 ehrenamtlichen Dozenten allein in Nordrhein-Westfalen ist auf den ersten Blick beeindruckend. Doch die Statistik relativiert das rühmenswerte Engagement einzelner Juristen leider sehr deutlich: Allein den Jahrgangsstufen 9 und 10 gehörten im jahrgangsstärksten Land der Bundesrepublik im Jahr 2015 nicht weniger als 305.898 junge Menschen an. Im besten Fall kommen auf einen Rechtsgelehrten im Schulbetrieb also rund 360 Schüler.
Und dann sind da noch 2,2 Millionen weitere…
Die Versorgung der rund 2,2 Millionen weiteren Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern wird damit noch nicht einmal abgebildet. Im besten Fall erfahren sie später bei der Aufnahme einer entsprechenden Ausbildung etwas an den Berufsschulen über das eigenwillige kaufmännische Zivilrecht. Oder, noch während der Schulzeit, mit etwas Glück im Geschichts- oder Politikunterricht einige Trivialitäten über das Grundgesetz.
Nicht unwahrscheinlich ist es also, dass sich die gruselige Praxis, den jungen Leuten erst zum Abitur einen billigen Druck des Verfassungstextes auszuhändigen, bis heute gehalten hat. Dabei hätte man im Zwangssystem Schule ja schon früher etwas damit anfangen können.
Großartige Jugendbücher wie "100 × Bürgerrecht" mit Texten zu den Grundrechten (1979), verfasst vom ehemaligen Spiegel-Korrespondenten in Karlsruhe, Rolf Lamprecht (1930–), und illustriert von der großartigen Marie Marcks (1922–2014), beweisen, dass man schon aus 12-Jährigen glühende Verfassungspatrioten machen kann.
Kinder können früher Recht lernen als sie dürfen
Der autobiografische Selbstversuch des Autors – das autodidaktische Studium von Lamprecht/Marcks als 12-jähriger Realschul-Dötz – wird nicht den höchsten Beweiswert für die Argumentation haben, mehr Recht an Schulen zu unterrichten. Bemerkenswert mag aber sein, dass einer der Hausgötter der pädagogischen Wissenschaften, der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896–1980), das Alter von etwa 12 bis 15 Jahren als jene Phase definiert, in der der Mensch befähigt ist, formale Operationen intellektuell zu bewältigen: Er schafft es nun, Probleme vollständig auf einer hypothetischen Ebene zu lösen – später im (Juristen-)Leben besser bekannt als Falllösungstechnik.
Mit Blick in die Schulstatistik allein von Nordrhein-Westfalen tut sich nun der Greffrath’sche Abgrund auf: Rund 800.000 Kinder fallen in diese Altersklasse, in der – folgt man der Doktrin Piagets – grundlegende Kenntnisse zum deutschen Recht vermittelt werden könnten.
Bei der Frage, ob dies denn notwendig sei – und überhaupt, nicht dass die Kinder hinterher auf den Gedanken kommen, sie müssten später alle einmal Jura studieren – kommen wir auf das Känguru zu sprechen. Denn dieses sprunghafte Stück australischer Fauna bietet ein beeindruckendes Beispiel für den Hunger junger Menschen nach normativer Unterweisung.
2/2: Rechtsprobleme mit leckerem Känguru
Bekanntlich liefert die sogenannte islamische Paralleljustiz in Deutschland nicht selten Anlass zu öffentlicher Empörung. Für die nähere Differenzierung zwischen zulässiger privater Schiedsgerichtsbarkeit und malignen Formen familiärer oder ethnischer Anmaßungen von Strafgewalt ist hier kein Platz.
In unserem Zusammenhang ist aber von Interesse, dass die Gelehrten des islamischen Rechts durchaus jugendgerechte Angebote zu einer fröhlichen juristischen Rabulistik machen, mit dem ein erster Schritt zur Entfremdung gegenüber dem deutschen Recht getan sein mag. Und von so viel lustiger Rabulistik und Vertrauen in die Erklärungsmacht der Rechtsgelehrten sollte man sich etwas abschauen – womit wir beim Känguru sind.
In einem Online-Forum für Freunde der schiitischen Geschmacksrichtung des Islam beispielsweise findet sich die Frage, ob Kängurufleisch halal ist, also nach muslimischen Speisegesetzen verzehrt werden darf, und, sollte dies nicht generell verneint werden, wie die Tötung beziehungsweise Schlachtung von Wildtieren vonstatten zu gehen habe.
Auch die türkische Religionsbehörde Diyanet als Vertretung der mehr sunnitischen Geschmacksrichtung des Islam hat sich bereits mit der Verzehrfähigkeit von Kängurufleisch befasst und ein entsprechendes Rechtsgutachten veröffentlicht.
Auslegungsdogmatik am Beispiel des Kängurus
Man wird sich nun vielleicht fragen, warum ausgerechnet solch absurde Beispiele für Rechtsprobleme aus orientalischen Normsystemen dazu einladen sollten, mehr juristisch qualifizierte Dozenten an die deutschen Schulen zu locken. Wer die Befähigung zum Richteramt hat, so die einfache Antwort, ist dazu ausgebildet worden, auf höchstem Niveau kritisch mit Normen, Rechtsgutachten und Präjudizien umzugehen.
Vor allem der deutsche Volljurist hat dabei in den vergangenen hundert Jahren bewiesen, dass er noch die absurdesten Normen ernstzunehmen in der Lage ist: Welche Norm gilt? Wie ist ihr Wortlaut auszulegen? In welchem Zusammenhang steht sie? Ist der Sachverhalt unter sie zu subsumieren? Wie kommen höherrangige Normen ins Spiel?
Was sagt uns "die Schrift" – sei es ein heiliges Buch oder das Gesetz? Nicht ganz zufällig entstanden die moderne protestantische Theologie mit ihrer Kritik an allzu unbedarfter Gläubigkeit und wesentliche Methoden der heutigen Rechtswissenschaft einigermaßen parallel an den deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts. Wäre es nicht eine schöne List der Vernunft, würden Anwälte Kindern beibringen, wie man Texte aller Art nach den Regeln ihrer gewitzten Kunst auslegen kann?
Recht hilft aus postmoderner Standpunktlosigkeit
Natürlich ist dies ein Maximalziel. Doch den wirklich heiligen Ernst im Umgang mit Texten können heute nur Juristen ernsthaft vertreten und ihn so – hoffentlich - Schülern vermitteln. Im schulischen Alltag gibt es ihn nicht. Da heißt es: Interpretiere das Gedicht und gebe deine begründete Meinung dazu ab. "Begründete Meinung" wiederum heißt: Süßer Senf, bitte nicht zu scharf. Freiheit, Leben und Vermögen hängen von solchen Interpretationen eben nicht ab.
Dass es bei einer Auslegung auf etwas ankommt, wo lernen junge Menschen das denn noch in einem öffentlichen Palaver, in dem jeder politische Standpunkt demoskopisch getestet und PR-mäßig weichgespült wird?
Und natürlich tut auch platte Rechtskunde allein schon not. Über Handyverträge wollen Jugendliche unterrichtet sein und darüber, ob sie Dateien legal herunterladen. Und wenn demnächst das neue Sexualstrafrecht mit seinen schändlich unbestimmten Begriffen auf das noch unbedarfte Paarungsverhalten der Pubertierenden stößt, werden Anwältinnen und Anwälte vielleicht noch froh sein, wenn sie mit den jungen Männern und Frauen nur über die Rabulistik des Kängurus sprechen brauchten.
Der Autor Martin Rath arbeitet als freier Lektor und Journalist in Ohligs bei Solingen.
Martin Rath, Juristische Allgemeinbildung: Mehr Rechtswissenschaft an Schulen . In: Legal Tribune Online, 31.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20152/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag