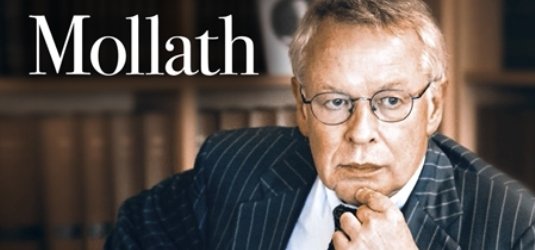Viel ist geschrieben worden zu Gustl Mollath – und nun noch ein bisschen mehr. Unter dem Titel "Der Fall Mollath" legt sein einstiger Verteidiger Gerhard Strate seine eigene Darstellung des historischen Justizskandals vor. Darin geht er vor allem mit der forensischen Psychiatrie hart ins Gericht, und liefert ein lesenswertes Fazit aus ungewöhnlicher Perspektive, findet Henning Ernst Müller.
Eine Vorbemerkung: Mit dem Fall Mollath habe ich mich selbst intensiv befasst und mich mehrfach dazu geäußert. Mit Herrn Mollath und seinem Strafverteidiger Strate stimmte ich dabei in vielen Detailfragen und in der Gesamtbewertung überein, ohne dass ich in die Verteidigung einbezogen war. Im Vorwort des besprochenen Buchs wird mir neben anderen persönlich gedankt für meine Kommentare zum Wiederaufnahmeverfahren. Insofern bin ich als Rezensent natürlich nicht ganz unbefangen.
Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Mollath ist öffentlich besser dokumentiert als wohl jedes andere bisher durchgeführte Strafverfahren in Deutschland. Die Verteidigung hat - ebenso wie zuvor schon einige Unterstützer Mollaths - durch die Publikation von Schriftsätzen, Hauptverhandlungsmitschriften und anderen Dokumenten für eine einzigartige Transparenz in diesem Justizskandal gesorgt. Dies hat es jedem Interessierten ermöglicht, das Verfahren detailliert zu verfolgen.
In einem Gespräch, das ich kurz vor Herausgabe des Buchs mit Rechtsanwalt Strate führte, bestätigt er meine Vermutung, dass die intensive Öffentlichkeitsarbeit ganz entscheidend zum Erfolg im Fall Mollath beigetragen habe. Eine solche offene Debatte biete sich zwar nicht in jedem Verfahren an – gerade das Wiederaufnahmeverfahren sei jedoch prädestiniert dafür.
Beklemmende Schilderung des Ausgeliefertseins
Der ausführliche öffentliche Dialog ließ es fraglich erscheinen, ob Strate jenen, die daran teilnahmen, in seinem Buch überhaupt noch Neues würde mitteilen können. Andere Bücher zum Fall Mollath waren bereits erschienen ("Die Affäre Mollath" von Ritzer/Przybilla; "Staatsversagen auf höchster Ebene" von Pommrenke/Klöckner), als Strate selbst noch mitten in den Vorbereitungen zur neu anberaumten Hauptverhandlung steckte. Die Darstellung des Strafverteidigers bietet jedoch eine Binnensicht, die man sonst nur selten in Buchform bekommt. Und es gelingt Strate fast durchweg, die Spannung zu erhalten, obwohl das Ergebnis des Prozesses ja bekannt ist.
 Zumindest für die allgemeine Öffentlichkeit noch eher unbekannt könnten die Ereignisse sein, die Strate mit dem Begriff der "Entrechtung" bezeichnet. Es geht um den Umgang mit dem zunächst zur Beobachtung (nach § 81 Strafprozessordnung, StPO) und später vorläufig (nach § 126 a StPO) untergebrachten Bürger Gustl Mollath. So entsteht ein beklemmendes Gefühl, wenn die das Recht beugenden Handlungen eines Vorsitzenden Richters am LG und die Willfährigkeit einer Amtsrichterin gegenüber den Psychiatern beschrieben werden.
Zumindest für die allgemeine Öffentlichkeit noch eher unbekannt könnten die Ereignisse sein, die Strate mit dem Begriff der "Entrechtung" bezeichnet. Es geht um den Umgang mit dem zunächst zur Beobachtung (nach § 81 Strafprozessordnung, StPO) und später vorläufig (nach § 126 a StPO) untergebrachten Bürger Gustl Mollath. So entsteht ein beklemmendes Gefühl, wenn die das Recht beugenden Handlungen eines Vorsitzenden Richters am LG und die Willfährigkeit einer Amtsrichterin gegenüber den Psychiatern beschrieben werden.
Strate macht deutlich: Hier wurde ein Mensch einem System ausgeliefert, in dem seine zulässigen und sachlich begründeten Beschwerden nicht einmal mehr bearbeitet wurden. Im diametralen Gegensatz zur rechtsstaatlichen Intention richterlicher Kontrollfunktionen mutierte das Verfahren an dieser Stelle zu einer kafkaesken Realität, in der ausgerechnet die Richter zu Beteiligten an der Rechtlosstellung Mollaths wurden, die sich in einer siebeneinhalbjährigen Unterbringung manifestierte.
Vollständige Absage an die forensische Psychiatrie
Eine überraschend stark hervorgehobene Rolle im Buch nimmt Strates Kritik an der forensischen Psychiatrie ein. Offenbar hat sich der Fokus seiner Aufmerksamkeit von der detaillierten Justizkritik, die im Wiederaufnahmeantrag im Vordergrund stand, auf eine mehr allgemeine Kritik der forensischen Psychiatrie verlagert. Ausgehend von drei forensisch-psychiatrischen Gutachten im Fall Mollath wird die gesamte Fachrichtung als "Wissenschaft der Stigmatisierung" (S. 59) beurteilt. Sie trage "dem uralten Bedürfnis Rechnung, Individuen oder willkürlich definierte Menschengruppen vom allg. geltenden Rechtssystem auszuschließen" (S. 61). Zweck der Begutachtung sei "einzig und alleine die Befriedigung archaischer Instinkte" (S. 62). Strate schreibt der Branche "Pathologisierungswahn" gepaart mit "Omnipotenzfantasien" zu (S. 75). Insgesamt bedeutet dies nichts weniger als die vollständige Delegitimierung der forensisch-psychiatrischen Gutachtertätigkeit durch Strate.
Ob diese umfassende Abrechnung angemessen ist, scheint mir fraglich. Aber mit seiner Fundamentalkritik holt Strate gleichsam nach, was im Prozess weniger präsent war: Die Verteidigung wollte die "Kiste Psychiatrie" in der Hauptverhandlung eigentlich geschlossen halten. Und als das Gericht doch einen Psychiater zu Mollaths Geisteszustand anhörte, war dessen Stellungnahme so wenig zielgerichtet, dass eine zu harte Kritik daran jedenfalls verteidigungstaktisch untunlich schien: Die Verteidigung wollte ja die Möglichkeit eines Freispruchs "in dubio pro reo" nicht torpedieren.
Der Hinweis Strates auf einzelne aufrechte Persönlichkeiten in der forensischen Psychiatrie (S. 204) und auch die Tatsache, dass er sein Buch dem Psychiater Johann Simmerl aus Mainkofen gewidmet hat, erscheint vor dem Hintergrund seiner fundamentalen Kritik etwas verwunderlich: Denn eigentlich gelte für die forensische Psychiatrie der Ausspruch Adornos: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" (S. 171).
Auch wenn sich daher der gegenteilige Eindruck bei der Lektüre gelegentlich aufdrängt, erklärte Strate im Gespräch, es handele sich nicht um ein "Anti-Psychiatrie-Buch".
2/2: Nur punktuelle Justizkritik
Im Vergleich zur Kritik an der forensischen Psychiatrie, die prinzipiell und unversöhnlich vorgetragen wird, tritt die Justizkritik im Buch etwas in den Hintergrund. Sie bezieht sich jedenfalls nicht auf das Gesamtsystem Justiz oder auf grundsätzliche Konstruktionsfehler bei der justiziellen Anwendung der §§ 20, 21, 63 StGB, sondern primär auf das Versagen einzelner Personen innerhalb dieses Systems.
Strates Buch bietet ganz unabhängig davon eine gut verständliche, ja spannende Darstellung des gesamten Falls und eine mit Zitaten aus der Hauptverhandlung gespickte, anregend erzählte Prozessgeschichte.
Angesichts der vielen Stunden Hauptverhandlung wird es keine ganz leichte Aufgabe gewesen sein, hier eine Auswahl zu treffen, die sich notwendigerweise auf kurze prägnante Ausschnitte beschränken muss. Aber die Selektion ist durchweg gelungen. Zudem verweist Strate den kritischen Leser auf die kompletten Mitschriften, die nach wie vor auf seiner Website verfügbar sind.
Streit mit Mollath bleibt Randnotiz
Wer allerdings gehofft hat, Näheres über das tagelang die Berichterstattung dominierende Zerwürfnis mit seinem Mandanten zu erfahren, dürfte enttäuscht sein. Eine seine Schweigepflicht verletzende oder dem früheren Mandanten zusätzlich schadende Äußerung war hier aber auch kaum zu erwarten. Trotz des Streits, der im Buch weder verschwiegen noch besonders betont wird (S. 248, S. 254 f.), bleibt Strate loyal.
Auf meine Frage, warum dieser Konflikt überhaupt in der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung ausgetragen werden musste, bekräftigt Strate sein Vorgehen: Es sei notwendig gewesen, Herrn Mollaths öffentlicher Darstellung angeblicher Versäumnisse der Verteidigung deutlich entgegenzutreten. Auch dem unangemessenen Angriff seines Mandanten auf das Gericht habe er in der Hauptverhandlung begegnen müssen.
"Für diese Republik eine Schande"
Im Buch lobt Strate die Kammer der Vorsitzenden Richterin Escher, obwohl das Urteil seinem damaligen Mandanten nicht gefallen hat. Im Vergleich zur sonstigen Praxis habe sich diese Kammer enorme Mühe gegeben, die Sachverhalte aufzuklären.
Auch mit der in dubio pro reo-Anwendung des § 20 StGB auf einen der Tatvorwürfe ist Strate am Ende wohl einverstanden. Die Kammer war seiner Forderung, die früheren Angaben der Nebenklägerin vollständig als ungeeignet zu verwerfen, nicht gefolgt. Und nach der taktisch ungeschickten Einlassung seines Mandanten war § 20 StGB (angewendet nach dem Grundsatz "in dubio pro reo") immerhin der Weg zum vollständigen Freispruch. An dieser Stelle stimmte aber die Zielvorstellung des Verteidigers nun endgültig nicht mehr mit derjenigen seines Mandanten überein.
Strate beleuchtet mit seinem Buch den Fall Mollath aus der Sicht des Strafverteidigers. Es ist natürlich kein neutrales Buch geworden. Strate bleibt auf der Seite seines früheren Mandanten, dessen jahrelange Wegschließung "für diese Republik eine Schande" war und dessen "geraubte Jahre ihm niemand wiedergeben" könne. Und am Ende stellt Strate auch die berechtigte Frage, "wie viele Mollaths es wohl sonst noch geben mag" (S. 270).
Der Autor Henning Ernst Müller ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Regensburg. Er hat den Fall Gustl Mollath intensiv verfolgt und in zahlreichen Artikel und Diskussionen aufgearbeitet.
Das Buch "Der Fall Mollath: Vom Versagen der Justiz und Psychiatrie" ist im Orell Füssli Verlag, 2014 erschienen. ISBN: 978-3280055595
Prof. Dr. Henning Ernst Müller, Rezension zu Gerhard Strates "Der Fall Mollath": Natürlich kein neutrales Buch . In: Legal Tribune Online, 12.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14096/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag